Wahlen, Wähler und Gewählte
Wahlzeiten sind auch Zeiten zwielichtiger Bekenntnisse zum freien Willen des Bürgers.
„Der Staat besteht nun einmal aus seinen Bürgern, aus niemandem sonst. Das ist das Risiko der Demokratie. Wenn der permanente Gedankenaustausch versiegt, so wächst die Gefahr, daß die mündigen Bürger wieder in die Kolonne gezwungen werden. Und dort hat der Teufel leichtes Spiel“, jammert ein Kommentator über die Schwierigkeiten der Demokratie mit den Bürgern, aus denen sie besteht, und plagt sich auch dort, wo er die »Geistlosigkeit«, »Unwahrhaftigkeits«, »Diskussionsunlust« der Parteien im Wahlkampf beklagt, einzig um ihren staatserhaltenden Erfolg bei denen, die als Wähler gefragt und gefürchtet sind: „Die kommenden Wahlen werden von Wechselwählern entschieden, und sie werden mit Schlagworten nicht angezogen, sondern abgestoßen. Diese merkwürdige Unlogik der Parteien enthüllt besonders deutlich die Abneigung gegen geistigen Austausch. Das Bedürfnis, sich in seinen unbewußten Antipathien bestätigt zu sehen, ist offenbar größer als der Drang, andere zu überzeugen – sogar als Wahlen zu gewinnen.“ |
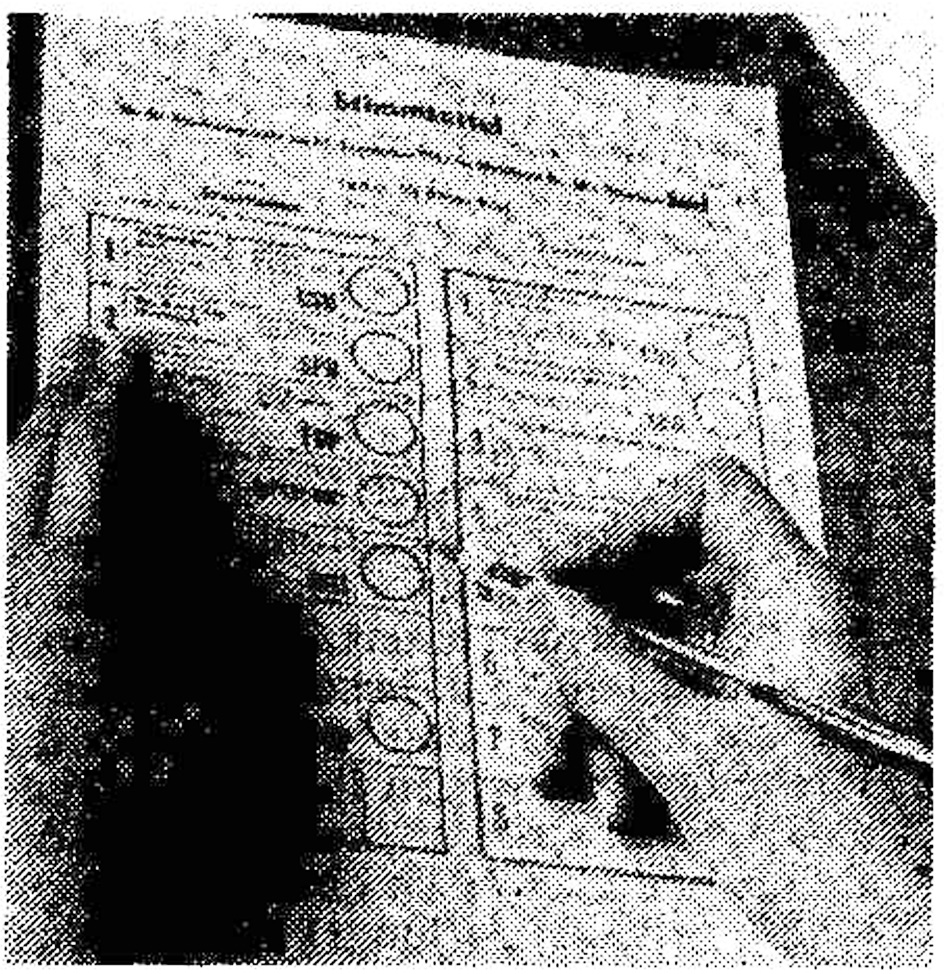 |
Repräsentieren und repräsentieren lassen
Die Parteien lassen sich freilich von ihrem besseren Ich ihren Realitätssinn nicht trüben. Sie pflegen ihren eigenen Umgang mit denjenigen, die sich alle paar Jahre unliebsam als zu berücksichtigende Willen praktisch in Erinnerung bringen, (vgl. letzte MSZ); und wenn Politiker neben ihrem Kampf um die Stimme jedes Bürgers auch ab und an vor einer ausgewählten Öffentlichkeit verlauten lassen, daß eine allzu hohe Wahlbeteiligung kein Gütesiegel einer funktionierenden Demokratie sei, oder wenn sie – wie jüngst Jimmy Carter in den USA – das Schütteln einer sechs- bis siebenstelligen Zahl von Händen als Einsatz für die Bürger und entsprechenden Anspruch auf deren Zustimmung reklamieren, dann legen sie das offen, was der Kommentator ihres Geschäfts mit seinen Phrasen meint: Der Bürger soll sich repräsentieren lassen und seine Willenskundgabe darauf beschränken, die Ausführung der staatlichen Belange gefälligst von seiner querigen Meinung unabhängig zu machen und den weisen Politikern zu überlassen, die besser wissen, was des Bürgers Wille ist – weswegen er auch nach der Wahl wenig zu bestellen hat. Die Politiker wollen sich vom heißgeliebten Bürger nicht ins Handwerk pfuschen sondern wählen lassen, und Politologen geben ihnen um des Staates willen recht:
„Sie werden oft den Vorwurf hören, als komme der Bürger nur alle vier Jahre bei der Bundestagswahl zu Wort und man habe ihn durch die parlamentarische Demokratie und das Fehlen der unmittelbaren Volksgesetzgebung »entmündigt«. Das stimmt schon insofern nicht, als zwischen den Wahlen zum Bundestag ständig Wahlen stattfinden, zu den Länder-, Kreis- und Gemeindeparlamenten; und auch kein Gemeinwesen Wahlkampf in Permanenz führen kann, wenn etwas geplant und realisiert werden soll. Der wirkliche Grund für die Reserviertheit des GG gegenüber einer unmittelbaren Volksgesetzgebung ist folgender: Man braucht hierfür eine klare »Ja-Nein-Alternative«. Diese aber versagt, wenn es gilt, den Bürger (z. B. durch Steuererhöhungen) zu belasten. Nach zwei Katastrophen war und ist es aber die deutsche Situation, ständig neue soziale Lasten an die Bevölkerung herantragen zu müssen … In derartigen staatlichen belastenden Eingriffs- und Ausgleichsaufgaben haben sie den eigentlichen Grund für den »Parlamentarismus«.“
Auf verschiedene Weisen dasselbe
Nach den diversen MSZ-Artikeln über die verschiedenen Parteien, über Parlament und Wahlkampf dürfte es keine Schwierigkeiten bereiten, einen solch verschwenderischen Umgang mit der deutschen Vergangenheit in unserer schnellebigen und traditionslosen Zeit zu entschlüsseln. Drum sei hier noch einmal mit wenigen Worten die traurige Realität nach zwei „Katastrophen“ umrissen, die zu anderen Gelegenheiten wohl auch als „Wirtschaftswunder“ und seine Folgen von Eingeweihten rosiger dargestellt wird: Wenn sich die Parteien gegeneinander für Freiheit, Aufschwung, soziale Sicherheit, kurz für das vielbeschworene Allgemeinwohl stark machen und die goldene Mitte beschwören, wenn sie sich im Parlament um die Staatsmaßnahmen streiten und wenn sie sich im Wahlkampf in aller Öffentlichkeit mit Geschick und Pathos ins „demokratische Abseits“ stellen, dann wollen sie nicht nur dasselbe, einen effektiven demokratischen Staat, sondern sind sich auch einig darin, daß dabei manche Bürgerwünsche auf der Strecke bleiben müssen. Deswegen war und ist es große Mode, dem Bürger zu versprechen, ihm zu seinem Vorteil kräftig eins drauf zu geben – wobei man keinen Zweifel darüber aufkommen läßt, wem da eins draufgegeben und wem da Vorteil verschafft werden soll. (vgl. MSZ 8/1976 „Die Krise“). Die Unterschiede und Gegensätze der Parteien aber, die dem demokratischen und parlamentarischen Getriebe Farbe verleihen und die sie sich in immer neuen kunstvollen Varianten wechselseitig mit Blick auf den Bürger unter die Nase reiben, verdanken sich der verschiedenen Weise, das Staatsgeschäft, – die Wirtschaft in Gang zu halten, anzugehen – ein recht aufreibendes Geschäft, – will doch der vielbeschworene Interessenausgleich nie reibungslos klappen –, das nicht zufällig immer wieder Konservative, Liberale und Reformer hervorbringt. Erstere sind unzufrieden, weil ihrem Streben nach einem starken Staat, der jeden zur Erfüllung seiner ihm zukommenden Aufgabe in der freien Wirtschaft anhält, beständig die Reformer in die Quere kommen („Aus Liebe zu Deutschland – Freiheit statt/oder Sozialismus“). Letztere kommen nicht zur Ruh, weil sie die Wirtschaft für die einen lukrativ und für die andern aushaltbar machen wollen, damit sie lukrativ bleibt, weswegen sie sich um die Arbeiter als Sand im Getriebe der freien Marktwirtschaft kümmern und sich beständig gegen Sozialismusvorwurf zur Wehr setzen müssen („Partei der deutschen Freiheit“, „Reform statt Reaktion“). Die Liberalen aber, die auf den Standpunkt des Bürgers stellen und ihn gegen dessen Ansprüche an den Staat ausspielen, sähen es am liebsten, wenn es den Staat nicht so sehr bräuchte, was sie durch staatlichen Einsatz für mehr wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu erreichen hoffen. („Leistung wählen“). In unfriedlicher Einmütigkeit streiten also die drei Parteien darum, wie der Staat und die Gesellschaft am besten erhalten bleiben können, weswegen ihre offenen Klagen über die Last der Verantwortung gegenüber den Wählern und ihre weniger offenen Beschwerden über die undankbare Aufgabe, neben dem sorgensvollen Staatswirken auch noch auf den Bürger Rücksicht nehmen und sich wählen lassen zu müssen, nur zu verständlich sind.
Trotz aller Klagen zweifeln bei uns außer einigen verrückten Linken, (die rätseln, wie sich die Unzufriedenheit der Arbeiter mit ihrer Wahlbereitschaft vertragen könne, und meinen, das immergleiche Wechselspiel von Regierung und Opposition, von Versprechungen und Nichterfüllung müsse den Massen zwangsläufig den Glauben an ihre Nation rauben,) selbst die ängstlichen Journalisten und Politiker nicht daran, daß das Volk hinter seinem Staat steht. Die hilfreichen Untersuchungen des Wählerverhaltens und demoskopischen Trendanalysen plagen sich nur mit der Frage, welcher Alternative diesmal die Wähler wohl den Vorzug geben werden; und die Politiker versuchen nur sich gegenseitig Stimmen abzuluchsen und die letzten trägen Reserven von „Wahlmüden“ für sich zu mobilisieren, in der Gewißheit, daß wenn nicht sie, die bürgerlichen Konkurrenzparteien gewählt werden. Denn diejenigen, die alle vier Jahre um Zustimmung gefragt sind, machen keine Anstalten, die Frage, wer sie regieren darf, nicht als ihr Anliegen aufzugreifen und sich zum Mittel des Staates zu machen. Sie schicken sich vielmehr erneut an, ihre Zustimmung zu den Parteien zu geben, die sich als ihre Vertreter anbieten, und sich damit den staatlichen Notwendigkeiten anzubequemen.
Die Bürger werden also wieder einmal den Zwang des Gesetzes –
„Alle Staatsgewalt geht vom Volk aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtssprechung ausgeübt.“ (Art 202 GG)
als ihr höchstes Recht wahrnehmen, wenn sie – mit gebührendem Ernst und Sonntagsanzug – sich ausnahmsweise als politische Subjekte betätigen, um dann für vier Jahre wieder ihr moserndes Einverständnis mit dem Staat, der sie regiert, zu leben. Die Wahrheit,
„daß in der Demokratie die einzelnen ihre Souveränität nur für einen Moment ausüben, dann aber zugleich wieder von der Herrschaft zurückzutreten“ (MEW 3/315)
– eine Tatsache, die, wie gesehen, von Demokratiefans gefeiert und durch die entsprechende Beschimpfung der Bürger als eigensinniger, verzichtsunwilliger und dummer Geschöpfe ergänzt wird –, betrifft alle mündigen Staatsbürger gleichermaßen, die Entmündigten, Irrenhäusler und Strafgefangenen ausgenommen, und doch vollbringen sie, weil sie alle dasselbe machen, sehr unterschiedliche Leistungen.
Frei, gleich und geheim darf jeder sein Kreuzchen hinter die Parteikandidaten machen und leistet mit dieser Abstraktion seinen persönlichen Beitrag zur mehrheitlichen Zusammensetzung einer staatlichen Körperschaft, die eine gebührende Weile in seinem Namen, aber ohne seine Zustimmung über ihn entscheidet. Weil zwar des Bürgers Stimme, nicht aber seine Motive zählen, weil seine Willenskundgabe Mittel für die Zusammensetzung von Parlament und Regierung aus den zur Wahl stehenden Parteien ist, gibt es für Politologen eine Menge Arbeit, um den Zweck der ganzen Veranstaltung durch Debatten über Mehrheits- und Verhältniswahlrecht, Zwei- und Mehrparteiensystem, 5-Prozent-Klausel, innerparteilicher Demokratie usw. in die Frage von Wählerrepräsentation contra Regierungsfähigkeit umzudeuten. Sie begrüßen im „Wählerwillen“, der im Stimmenverhältnis der Parteien und damit in der Anzahl ihrer Kandidaten resultierenden willentlichen Unterwerfung der Bürger, die höchste Stufe menschlicher Zivilisation. Ihrer Zufriedenheit gesellen sich andererseits die linken Nörgler zu, die der Abstraktion des Wählerwillens noch gute Seiten abgewinnen, indem sie dessen Realität in den Wahlergebnissen mit dem Ideal des wahren Volkswillens konfrontieren, auf dem ein anständiger Staat beruhen solle, der aber in bürgerlichen Wahlen immer manipuliert und unterdrückt werde – außer in den paar 0,... %, die ihre jeweiligen Parteien ergattern. Vergeblich rennen sie damit gegen den staatsbürgerlichen Stolz derjenigen an, die wissen, daß sie frei wählen und wählen wollen, weil es für sie um einen anderen Vergleich geht. Denn die Bevölkerung ist mit dem Staat und den gebotenen Alternativen soweit im reinen, daß sie ihn unterstützen durch den Vergleich ihrer Ansprüche an den Staat mit dem, was die Parteien machen und versprechen, ein Vergleich, der zwar nie in Zufriedenheit, wohl aber je nach Grad der Übereinstimmung im Kreuzchen für eine bestimmte Partei sein staatstreues Resultat findet. Als Parteianhänger oder Wechselwähler, der es jedesmal mit einer anderen Partei versucht, gibt er zwar die Differenz zu den Parteiprogrammen und Wahl, die die Bürgerinteressen zum Vorschlag für das Staatshandeln ausgeglichen haben, nicht auf, beschränkt sich aber damit, die Partei zu wählen, bei welcher er seine Wünsche an den Staat am besten repräsentiert sieht, verhilft damit denjenigen an die Macht, die den staatlichen Auftrag zur entsprechenden Berücksichtigung aller Interessen an ihm vollziehen, und erhält sich seinen freien Willen im Nörgeln.
Damit löst sich auch das Rätsel, wieso die freie, gleiche und geheime Wahl von allen gewollt wird, obwohl sie nicht allen zugute kommt. Alle bauen eben auf den Staat, was noch lange nicht für alle das gleiche heißt. Die einen wählen in der tröstlichen Gewißheit, daß mit ,,Freiheit statt Sozialismus“, ,,Reform statt Reaktion“ und „Leistung wählen“ ihr freies Eigentum gemeint ist, ihre Bedürfnisse Maßstab der Reform sind und ihre Leistung anerkannt wird, da sie diejenigen sind, die den Aufschwung bewerkstelligen und dafür Hilfe erwarten können, weil die Nation sich an ihrem Reichtum mißt. Sie können sich den Luxus der unzufriedenen Erwägung erlauben, welche Partei ihren Reichtum am besten in Schwung halten hilft. Sie können die SPD in die linke Ecke verdammen und aus ihrer Regierung Kapital schlagen, auf den Staat schimpfen und froh darüber sein, daß er ihnen in bequemer, wenn auch nicht immer störungsfreier Arbeitsteilung, Voraussetzungen bereitstellt, mit denen sie etwas anzufangen wissen, und wo er sie an ihre Pflichten gegenüber der Nation erinnert, ihn auch noch legal und halblegal bescheißen. Kurz: für sie stimmt unter dem Strich die Rechnung, weswegen ihre Staatstreue auch ungebrochen ist (solange nicht die Bilanz dringend nach einem leistungsfähigeren Staat verlangt) und die Wahl ein rechter Sonntagsspaziergang für die eigenen Alltagsinteressen ist. Sie sind denn auch nie gemeint, wenn über die Unmündigkeit, Staatsverdrossenheit und Unzufriedenheit der Bevölkerung lamentiert wird.
Wie immer („Wir müssen alle den Gürtel enger schnallen“, „Wir sind alle gefordert“) gilt die Schelte der schlechten Staatsbürgermoral denjenigen, die eh beständig eins draufkriegen und sich bei ihren fruchtlosen Anstrengungen, den Parteien gute Seiten abzugewinnen. auch noch die mangelnde Einsicht vorwerfen lassen müssen, daß ihre Dienste noch lange nicht zu „überzogenen Ansprüchen“ berechtigen. Des Staates ungeliebte Kinder wollen dennoch nicht von ihm ablassen, verdanken sie ihm doch die kümmerlichen Rechte und Segnungen, die ihr Lohnarbeiterdasein fristbar machen. Rechte, die sie ihm freilich noch abringen mußten und die sie auf die geordneten Bahnen bürgerlicher Interessenvertretung verpflichten. Weil sie den Staat brauchen, um als Arbeiter am Leben zu bleiben, sind sie für ihn und stellen in der Wahl den Vergleich an, der ihnen zukommt, den des geringeren Schadens. Statt zu merken, daß sie allen Grund haben, im Staat und seinen Parteien keine rechten Alternativen zu sehen, nähren sie die Illusion, bei den verschiedenen Parteien könne auch für sie Unterschiedliches herausspringen. Weil sie sich die Erfahrung ihrer ständigen Plage mit dem mangelnden Gerechtigkeitssinn derjenigen erklären, die ihnen ihre Leistung mit Geld entlohnen, wählen sie die SPD, von deren Reformen sie endlich den gebührenden Anteil an der Wirtschaft, der sie sich zur Verfügung stellen und weniger Schinderei erhoffen. Soweit sie aber den geringen Vorteil ihrer eigenen Anstrengungen den Mitkonkurrenten und dem Staat, der die Leistungsschwachen bevorzuge, in die Schuhe schieben, wählen sie CDU, weil sie sich vom starken Staat die Freiheit erhoffen, sich auf Kosten anderer besser durchsetzen zu können. Die FDP jedoch macht bei ihnen kaum Staat, weil sie für ihre Ansprüche so recht keinen zu bieten hat.
Die unverbesserlichen Arbeiter lassen sich auch durch die bittere Erfahrung, daß für sie so oder so wenig rausspringt, nicht davon abbringen, auf den Staat zu bauen (die Gewerkschaften haben es da soweit gebracht, sich dem Staat als verständnisvoller Korrektor anzubieten). Sie opfern auch im Herbst wieder einen Teil ihrer Sonntagsruhe am Wahltag und machen ihr Kreuzchen, gehen freilich am Montag ihrem Alltagsgeschäft nach in der trüben Gewißheit, daß ihnen auch weiterhin die Früchte ihrer Arbeit nicht in den Schoß fallen werden, weswegen manche auch am Sonntag frustriert und bequem zuhause bleiben. Weil auch die Arbeiter mit ihrer Stimme „einmal in vielen Jahren die parlamentarische Klassenherrschaft sanktionieren“ (MEW 17 544), dem Staat also Wahlen als bequemes Mittel seiner Selbsterhaltung dienen – verwundert ihre bleibende Unzufriedenheit und die Agitation des Staates um ihre fernere Zustimmung, sowie die offenen und heimlichen Drohungen, es ginge zur Not auch anders, nicht. Weil sie als Arbeiter sich ihre Lage falsch erklären, verwundert es auch nicht, daß ihre Unzufriedenheit sich gegen die jeweils regierende oder nichtregierende Partei richtet und damit den Staat am Laufen hält. Eigentlich sollte auch keinen mehr die Unverfrorenheit wundern, mit der Revisionisten diese Arbeiter als betrogene Opfer für das entschuldigen, was diese sich selbst antun lassen, ebenso wenig die Schleimigkeit, mit der sie sich als unverbrauchte Alternative für ein besseres Staatsgeschäft anbiedern.
| Über Wahlen, was gewählt wird und wer zur Wahl steht siehe auch: MSZ Nr. 5 1975 (»SPD-Orientierungsrahmen 85«), MSZ Nr. 6 1975 (»Wie kürt man einen Kanzlerkandidaten«), MSZ Nr. 9 1976 (»FDP- Fortschritt durch Vernunft«), MSZ Nr. 10 1976 (»Das Parlament«) und MSZ Nr. 11 76 (»Wahlkampf 1976«). |
aus: MSZ 12 – Juli 1976