Patient des Jahres
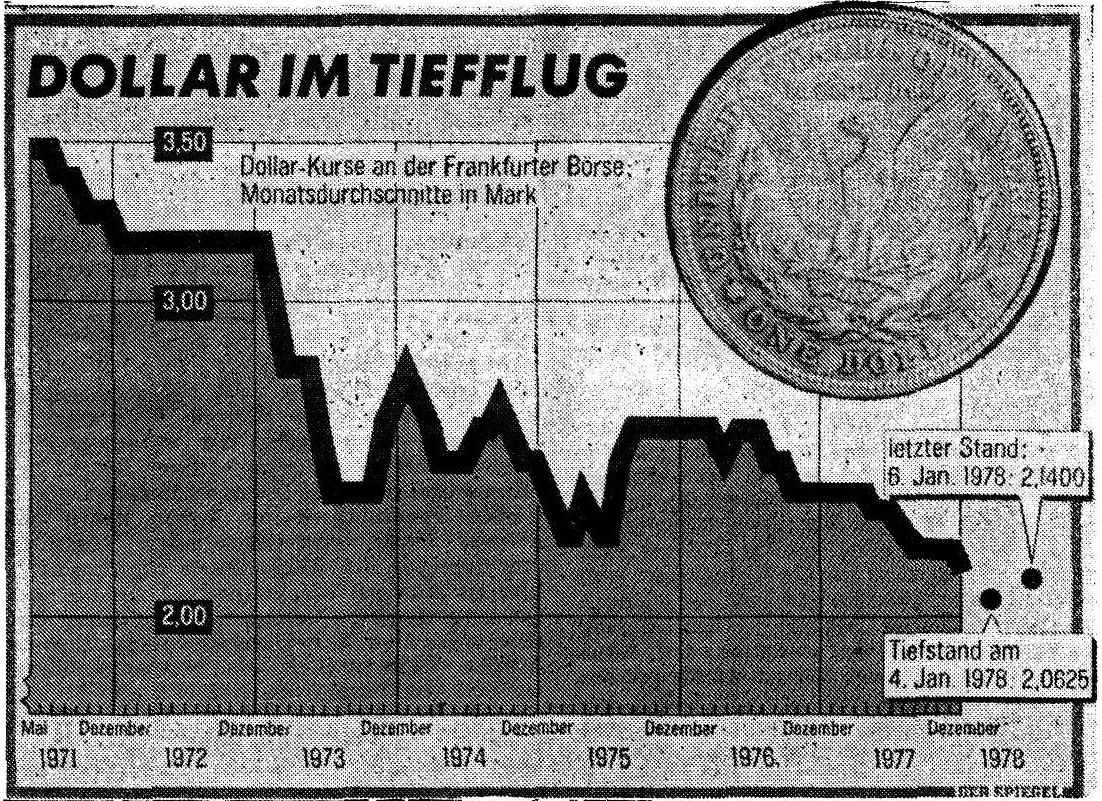
Die Parallele zum Wunsch nach guter Besserung, wie er üblicherweise ausgesprochen wird, besteht in der Hoffnung auf die Brauchbarkeit des Erkrankten, an seiner Gesundheit ist man nur höchst bedingt interessiert. Berechnung dominiert das Verhältnis zum Patienten Dollar, weshalb sich auch keine rechte Lust einstellen will, die Gründe für seinen Verfall auszumachen. Wer will denn schon wissen, daß der Dollar ein nationales Kreditgeld ist und aufgrund dessen mit seiner Funktion als internationales Zirkulations- und Zahlungsmittel in Kollision gerät? Wen interessiert es schon, daß ein internationales Kreditgeld, die Ökonomisierung des Goldes, selbst dann Hader und Zwietracht säen muß, wenn die Staatsmacht, die hinter dem nationalen Kreditgeld steht, eine ansehnliche U-Boot-Flotte ihr eigen nennt? Wer kümmert sich denn heutzutage noch um Ökonomie?
„Die Erklärung? Rationales und Psychologisches ergeben eine bunte Begründungsmixtur.“ (Thoma in der „Süddeutschen Zeitung“)
Das Geld hat es nun einmal so an sich, daß, je mehr man praktisch mit ihm zu tun hat, man auf die theoretische Beschäftigung mit ihm verzichten kann. Wenn man mit einem runden Tisch und einer entsprechenden Batterie von Telephonapparaten den Preis von ein paar Papierzetteln zu seinen Gunsten verändern kann, braucht man dazu nicht die geringste Ahnung davon, was es mit diesen Zetteln auf sich hat. Und deswegen hat die MSZ-Redaktion auch all die langwierigen, umständlichen Erklärungen über die internationale Zirkulation, Wechselkurs, Devisenhandel etc. aus dem Artikel gestrichen, zumal einem sowieso niemand abnimmt, daß in einer Zeitung etwas anderes als Meinungen stehen. Konkrete Handlungsanweisungen kommen bei dem theoretischen Geseiche ohnehin nicht zustande: weder Tips für den billigen Urlaub noch die praktisch bedeutsame Perspektive eines mit seinem Weltwährungssystem verfaulenden (Dollar-)Imperialismus könnte man sich davon versprechen. So bleibt kein anderer Ausweg, als den Kritikern dieses Blattes wieder einmal recht zu geben und ein paar feuilletonistische Zeilen über den Kursverfall des Dollar zu Papier zu bringen. Freilich kommt dabei nur heraus, was auf dem Weltmarkt zur Zeit los ist.
Also wie gesagt, der Dollar ist zunächst ein nationales Kreditgeld. Das wäre noch nicht weiter schlimm. Wer ist das nicht, die Mark, der Schilling, der Franken. Während aber von den anderen Währungen hauptsächlich Kreuzworträtsel leben (Womit bezahlt der Samurai seine Geisha? 3 Buchstaben), hat der Dollar seit 1944, mitten nach dem Krieg, eine zusätzliche schwere Aufgabe übernommen; Internationales Zirkulations- und Zahlungsmittel. Natürlich hätte das auch jede andere Währung sein können – bloß, es konnte keine andere sein. Das kam daher, daß ein nationales Kreditgeld, soll es für die Rolle des Mittlers im Handel zwischen den Völkern taugen, zuerst einmal als nationales Kreditgeld etwas gelten muß. Und wo, außer bei den Yankees, gab es schon das auf tatsächlichen Reichtum und seine produktive Vermehrung gegründete Vertrauen in vom Staatschef unterzeichnete Banknoten? Nur in den USA waren Industrie und Handel nicht im Dienst an der Nation aufgegangen. Dagegen, daß die einzige intakte Handelsnation dem Weltmarkt ihre Währung als allgemeingültiges Kreditgeld offerierte, gab es also ebensowenig zu sagen, wie gegen die geringfügigen Vorteile, die die USA dafür haben wollten. Denn immer, wo die ökonomische Konkurrenz zu einer Entscheidung geführt hat, ist es keine Frage, wer recht hat. So wurde auch Keynes pfiffig erdachtes Auskunftsmittel „BANCOR“ überflüssig. Das heißt natürlich nicht, daß mit Bretton Woods die Konkurrenz zwischen den Nationen entschieden wurde – eine Entscheidung, und zwar eine höchst vorläufige, fiel dort über eine Bedingung der internationalen Konkurrenz.
Die soziale Funktion des Geldhändlers
Während sonst auf dem Markt mit Haken und Ösen, vor allem aber mit Preisen gestritten wird, enthält der internationale Wettbewerb ein zusätzliches belebendes Element. Es wird auch noch um den Maßstab der Preise gestritten, eine Sportart, die innerhalb einer Nation undenkbar wäre. Man stelle sich vor, einem Familienvater, der ein letztes Bier bestellt, wird die Annahme seines Zehn-Mark-Scheins mit dem Hinweis auf seine zerrütteten Familienverhältnisse, die das Vertrauen in sein Geld untergraben hätten, verweigert. Und das hat seinen Grund. Während Familienväter nie ihre Familie damit ankurbeln, daß sie besonders investitions- und kauffreudigen Teilen derselben Kredite zur Verfügung stellen, ist diese Praxis innerhalb von Staaten gang und gäbe. Moderne Staaten haben nämlich die Angewohnheit, den Kredit als einen Hebel der Akkumulation selbst dann noch einzusetzen, wenn er schon längst kein Mittel der Wirtschaft mehr ist; und manche Wirtschaftssubjekte pflegen dieses Vorgehen ihres Staates nicht nur zu verlangen, sondern auch in der Gewißheit, daß es nur auf sie ankommt, schamlos auszunützen – und dabei schert es sie nicht im mindesten, wenn sie der Stabilität des Umlaufsmittels gewissen Schaden zufügen. Wenn die staatlich kontrollierte und betriebene Kreditgeldschöpfung die Sicherheit bietet, nicht nur aus Geld, sondern auch aus zirkulierenden Schulden Kapital zu machen, dann stört es den Menschenschlag des Unternehmers wenig, wenn er durch die Indienstnahme dieses Mittels dazu beiträgt, daß mehr produziert wird, als König Kunde bezahlen kann und die Inflation ihr Unwesen treibt. Hauptsache – man selbst ist nicht der Leidtragende und Vater Staat sorgt auch nach Kräften dafür, daß es gesunde Betriebe nicht trifft. Ein bißchen Inflation ist von diesem Standpunkt aus also gar nicht weiter schlimm; sie wird einem nur übelgenommen von den Geschäftspartnern jenseits der Grenzen, die bemerken, daß ihre Finanzkraft nachläßt, sobald sie sich, mit der Währung einer fremden Nation ausgestattet, als Käufer betätigen.
Als Handelspartner fremder Zunge kommen sie nicht umhin, außer auf die Wohlfeilheit eigener und fremder Waren auch noch auf das staatlich modifizierte Entgelt des Ge- und Verkauften zu achten. Deswegen muten sie auch den bereits im Inlandsgeschäft mit mancherlei Diensten betrauten Bankangestellten eine zusätzliche Aufgabe zu, welche diese freudig übernehmen, weil sich aus dem praktischen Vergleich der Währungen ein zusätzliches Geschäft machen läßt. Sie handeln mit Devisen und betreiben damit Kurssicherung; indem sie aus den Schwankungen des nationalen Kreditgelds ihren Profit ziehen, teilen sie ihren Kollegen von der Industrie- und Handelsfront mit, welche Bedingungen diese in ihren jeweiligen Einkaufs- und Anlagesphären antreffen. Insofern ist die Devisenspekulation nichts Verwerfliches, obwohl sie von der Gebrechlichkeit anderer Leute Währungen lebt.
Wechselkurs – Keine Klassenfrage
Währungen haben eben ihren Preis oder der Wechselkurs ist ein Index dafür, wieweit sich Nationen gegenseitig Vertrauen schenken, d.h. die Wirtschaft der anderen für sich brauchbar gemacht haben. So hat der Wechselkurs wie alles auf der Welt – außer dem Kommunismus – seine 2 Seiten. Ruiniert man den Konkurrenten, ist man den Kunden los – begünstigt man den Kunden, treibt er schädlichen Wettbewerb. Zahlungs-, Handels- und sonstige internationale Bilanzen sind ein Kreuz. Je besser sie stehen, desto gefährlicher sind sie und wenn sie negativ stehen, hat man auch nichts zu lachen. „Die deutsche Mark ist hart“ (Helmut an Silvester*1) „und das macht uns Sorgen“ (Helmut an Silvester), ohne daß uns die Arbeiterklasse in Wechselkursfragen dreinredet, d.h. der soziale Friede auf dem Spiel steht. Hier, im Feld des internationalen Handels, gibt es keine ungetrübte Freude. Kaum hat man einen Konkurrenten aus dem Feld geschlagen, merkt man, wie abhängig man von seiner Kaufkraft ist. Kaum haben die Deutschen und die Japaner mit ihren Wirtschaftswundern den Amis gezeigt, was Wertarbeit und Sukiyaki zuwege bringen, müssen sie auch schon feststellen, daß eine geschwächte US-Wirtschaft auch ihre Schattenseiten hat. Wo der Wechselkurs die deutschen Exportchancen aus amerikanischer Sicht nicht genügend mindert, hebt die alte Debatte über Schutzzoll und Freihandel an, so daß es nicht verwundert, daß außer Stützungskäufen rege diplomatische Begegnungen stattfinden. Bündnisverhandlungen, Deutschland (West) mit USA gegen schlitzäugige Transistorfritzen, die unsere Werften ruinieren. Dollar könnte gesund werden, wenn Carter und Co. gescheite Wirtschaftspolitik machen würden. Wir helfen auch dabei. Wer tut unser Bestes? Friedliche Lösungen, untereinander sowieso, aber auch in Afrika, weil sonst sozialer Unfriede auch noch das Geschäft ruiniert. Keinen demokratischen Fanatismus, Wirtschaftsboykott gegen Südafrika und so, denn das schadet nur den kleinen Leuten da unten. Währungsprobleme, mit denen insbesondere die deutsche Wirtschaft konfrontiert ist, sind also eine delikate Angelegenheit. Sie lassen den Staatsmann in die Grenzfragen politischer Verantwortung vorstoßen. Er, der weiß, daß unser aller Wohl mit der Übervorteilung anderer Nationen steht und fällt, aber auch fällt und steht, kämpft im Osten, im Nahen Osten, im Nord-Süd-Dialog (Politik und Geographie!) um friedliche Lösungen und beweist damit, daß er den Vorteil der deutschen Wirtschaft – auf Kosten anderer versteht sich – noch ohne härtere Bandagen durchsetzen können will. Vielleicht wird eines gar nicht so fernen Tags die DM Leitwährung, viele unserer Firmen fakturieren ja schon längst nicht mehr in Dollar und sie tun gut daran, denn selbst, wenn das „Problem Nr. 2“, die Arbeitslosigkeit, gelöst wäre, hätte die deutsche Wirtschaft bei ihrem Wachstum noch manches internationale Hindernis zu beseitigen. Journalistisch gesprochen: die besten Artikel sind natürlich die, welche vom Dollarverfall über die Arbeitslosigkeit („Weg von der Straße", „Recht auf Arbeit“ und andere faschistische Parolen) die Kurve zur Tarifrunde kratzen. Von der Härte der DM zur beängstigenden Aufweichung des Dollars über die Gefährdung des Wachstums mangels Exportchancen zum unabdingbaren Beitrag der lohnpolitischen Vernunft: weniger Lohn = mehr Wachstum. Wenn der Dollar sonst schon zu nichts mehr zu gebrauchen ist, dann wenigstens zur moralischen Aufrüstung des eigenen Arbeitsvolks. Ohne Fleiß und Bescheidenheit keine stabile Währung. Nieder mit den chronisch Unzufriedenen (Helmut an Silvester).
Miteinander – Füreinander oder: Eine Mark für Jimmy ...
Doch zurück zum Thema. Es geht ja schließlich um Wechselkurse und damit nicht um den sozialen Frieden, sondern um die Übereinkunft zwischen Nationen, bei deren Gelingen wie Nicht-Gelingen die arbeitende Klasse stets nur die Rolle eines Mittels spielt. Ideologische Dogmen des Klassenkampfes haben noch nie zur Klärung ökonomischer Sachfragen beigetragen. Die währungspolitischen Probleme bedürfen zu ihrer Lösung am allerwenigsten der an Gruppeninteressen orientierten Vorstellungswelten (wann hat je ein Marxist einen ernstzunehmenden Vorschlag zur Regelung der Wechselkurse eingebracht?); hier ist man auf die politische Phantasie von Leuten angewiesen, denen die Beseitigung von Schwierigkeiten in der immer komplexer werdenden Weltwirtschaft ein ernstes Anliegen ist. Süßliche Termini für Modelle des eigenen Vorteils sind gefragt. Die preußische Preisfrage „Was ist Aufklärung?“ lautet doch heute ganz anders: feste oder flexible Wechselkurse? Natürlich sind Wechselkurse nie fest, weil ein Ergebnis der Konkurrenz, und darum auch überhaupt nicht flexibel, doch ist damit gegen die Ideale nationaler Währungspolitik überhaupt noch nichts gesagt. Man kann ja auch die Einheit von fixen Wechselkursen und ihrer Flexibilität in Form von Reptilien organisieren und sich Gedanken darüber machen, wie man den Franzmännern die Launen austreibt, die sie immer wieder dazu bewegen, ihre Mitgliedschaft beim gesamteuropäischen Lurchi aufzukündigen.
Und wer könnte sich angesichts der Krise des Weltwährungssystems der Frage verschließen, ob denn nicht unter der Schirmherrschaft von Kurtl Waldheim ein stets in Gold konvertierbares Weltgeld kreiert werden kann. Außer ein paar Fachökonomen – so lautet unsere berechtigte Klage – pflegt niemand mehr die monetären Ideale imperialistischer Konkurrenz. Nicht einmal von den Linken ist trotz ihres verzweifelten Be- und Anklagens der Funktionsunfähigkeit des Weltwährungssystems Konstruktives zu erwarten. Die theoretischen Köpfe halten seit. 1971 (in „Probleme des Klassenkampfs“ Nr. 1, Westberlin) dogmatisch an der These fest, daß der IWF „hinter dem gleißenden Geldschleier“ seiner Widersprüche nicht Herr wird, und die praktischen Abteilungen beharren zäh auf der These „Der Renminbi ist die stabilste Währung der Welt“ (Peking Rundschau). Fast lassen einen diese Burschen an der Ableitung des Golds als Weltgeld zweifeln, wie sie sich bei einem Gelehrten des 19. Jahrhunderts findet und in späteren Kapiteln eines weniger gelesenen Bandes desselben Autors in vorläufigen, theoretischen, empirisch noch lange nicht bestätigten Reflexionen über das Verhältnis von Edelmetall und Wechselkurs mündet. Wie so oft erweist sich der reale Sozialismus als Retter der materialistischen Welt- und Geschichtsauffassung. Da wird noch ausländische Ware, vom kanadischen Weizen bis zu Breshnews Whisky, für Gold erstanden. Die Gesetze der Konkurrenz werden eben am besten sichtbar, wenn man sich die Konkurrenz wegdenkt oder wenn sich jemand der Konkurrenz, der er ausgesetzt ist, zu entziehen meint.
Zur Frage Krieg und Frieden konnten und wollten wir uns bei dieser begrenzten Fragestellung natürlich nicht äußern.

__________________
*1 Gemeint ist vermutlich die Neujahrsansprache des Bundeskanzlers.
aus: MSZ 21 – Januar 1978