4 VARIATIONEN DER NATIONALEN SOUVERÄNITÄT
„Aus derselben Bestimmung geschieht, daß civilisierte Nationen andere, welche ihnen in den substantiellen Momenten des Staats zurückstehen, als Barbaren mit dem Bewußtseyn eines ungleichen Rechts, und deren Selbständigkeit als etwas Formelles betrachten und behandeln.“
(HEGEL, Rechtsphilosophie, § 351)
„Die modernen Verkehrsformen des Imperialismus sind Produkt der politischen Emanzipation auch von solchen Gesellschaften, die als Kolonien ganz zum Dienst an fremdem nationalen Reichtum gezwungen wurden ... Allerdings hat es mit der staatlichen Selbständigkeit als Resultat kolonialer Befreiung auch schon sein Bewenden: eine konkurrenzfähige Nationalökonomie, »normale« kapitalistische Ausbeutung samt Demokratie und der entsprechenden Wendung nach außen läßt sich nämlich mit einigen natürlichen Reichtümern und einer konzessionierten Souveränität nicht machen.“
(MARXISTISCHE GRUPPE, Imperialismus, in: Resultate Nr. 4)
I. Dacko für Bokassa – Der alten Kleider neuer Kaiser
 |
Während jeder Italien kennt, aber viele Schwierigkeiten haben, den Namen des Staatspräsidenten auf Befragung aufzusagen, ist die zentralafrikanische Republik nicht einmal dadurch zur Kenntnisnahme durch die Weltöffentlichkeit vorgedrungen, daß sich der Regierungschef vor zwei Jahren zum Kaiser krönen ließ. Während spätestens von da an dem illustren Potentaten die Aufmerksamkeit der Weltpresse sicher war, weiß von den Lesern und Fernsehzuschauern kein Mensch, daß es sich bei dem Landstrich, dem er vorstand, um einen Flecken Urwald und Trockensteppe an den Nebenflüssen des Kongo handelt, dessen Bewohner entweder von nomadisierender Viehzucht leben oder in den Slums der Hauptstadt Bangui dahinvegetieren. Daß die Lebenserwartung da unten bei knapp 35 Jahren liegt, ist keine Meldung wert. Hingegen war es noch jeder anständigen Illustrierten einen Farbbericht wert, daß Bokassas Krönung eine peinliche Imitation der Zeremonie war, mit der sich Napoleon die Krone der Franzosen aufs Haupt stülpte, weil man sich darin einig ist, daß schließlich ein gewaltiger Unterschied besteht zwischen der Kulturnation Frankreich und einem Dschungelstaat, dessen spärliche Goldvorkommen noch nie auch nur annähernd die Kosten der kolonialen Administration bzw. der Entwicklungshilfe aufgewogen haben, weswegen man den neuen Kaiser nie ohne Gänsefüßchen erwähnte. Keine Nachricht sind hingegen die Bemühungen französischer Konsortien, durch Flächenschlag Nutzholz aus Zentralafrika zu vermarkten, einige Baumwoll- und Kaffeeplantagen für den Export zu gewinnen, die die Anbauflächen für die Afrikaner so verringern, daß das übliche Hauptnahrungsmittel Hirse durch Importgetreide ersetzt werden muß, was dem Staat eine chronisch negative Zahlungsbilanz, der Bevölkerung, die im afrikanischen Durchschnitt nicht weiter auffallende Unterernährung nebst periodischen Hungersnöten und Seuchenepedemien erhält. |
Indem so lediglich Absonderlichkeiten des führenden Potentaten bebildert werden und die moralische Entrüstung des Abendländers sich über Grausamkeiten der Herrschaft, wie dem eigenhändigen Abknallen von Schulkindern wegen mangelnder Ehrerbietung vor Ihrer Majestät, genüßlich mokiert, muß nicht weiter auffallen, daß auch die Bokassasche Variante der Machtausübung nicht gerade originell und genau die Sorte Herrschaft ist, die es in diesen Breiten braucht, um die Staaten als die zu erhalten, zu denen man sie gemacht hat.
So waren auch beim jüngsten Staatsstreich die Details wichtiger: daß der neue Mann Dacko bereits vor Bokassa der alte Mann am Ruder gewesen ist, daß Bokassa in Paris nicht aussteigen durfte, an der Elfenbeinküste hingegen schon, weil dessen Diktator bereits 8 afrikanische Ex-Staatschefs beherbergt, und daß Bokassas Lieblingsfrau Catherine immer noch in einem kaiserlichen Privatschloß an der Loire residiert. Der in zivilisierten Breiten skandalöse Umstand, daß der Putsch mit Unterstützung ausländischer Interventionstruppen stattfand und daß deren Befehlshaber, Frankreichs Präsident, auch unumwunden zugab, seine Paras würden solange in Bangui bleiben, bis alles wieder seinen geregelten Gang gehe, fand keine kritische Würdigung. Das imperialistische Bewußtsein hält es für die größte Selbstverständlichkeit der internationalen Politik demokratischer Staaten, daß es in den Staaten der „Dritten Welt“ alles andere als demokratisch zugeht. So konnte sich auch Bokassa lange Jahre in der Gnade Giscards sonnen und Frankreich finanzierte ihm neben dem Militäretat auch die Krönung und den Hofstaat, solange dies der Aufrechterhaltung der gewünschten politischen Verhältnisse dienlich war. Als das Bekanntwerden von Einzelheiten des Bokassaschen Umgangs mit Gegnern seiner imperialen Würde seine Patennation und sogar den Staatspräsidenten persönlich in der europäischen Öffentlichkeit zu kompromittieren drohte, beschloß die Grande Nation den über die Stränge schlagenden Schützling zurückzupfeifen. Weil dieser die Frechheit besaß, auf die Streichung von Zuwendungen mit einer Reise nach Libyen zu antworten und Ghadafi einen Flugplatz zu verkaufen für dessen militärisches Engagement im Tschad, wo auch Frankreich Truppen stationiert hat, wurde Bokassa genauso lässig abserviert, wie man ihm vor 13 Jahren in den Sattel geholfen hatte. Imperialistische Nationen leisten sich eben auch moralische Rücksichtnahmen, wo mit ihnen Politik zu machen ist. Und in einem Land, wo es um mehr als die Absicherung des eigenen Einflusses über eine Region nicht geht, kann und wird die unblutige Auswechslung der jahrelang gehegten und gehaltenen Wunschfigur als Akt der zivilisatorischen Mission vollzogen. Man braucht in diesem Fall eben auf mehr nicht Rücksicht zu nehmen als auf das bedenkliche Kopfschütteln der Weltöffentlichkeit.
Der neue, alte Mann in Bangui, David Dacko, bislang so unbekannt wie sein Staat, wird Sorge dafür tragen müssen, daß ab sofort die Neger am Ubangi und am Schari schlimmstenfalls verhungern, und wenn, dann ordentlich umgebracht, keinesfalls aber von einem Kaiser aufgefressen werden, der offensichtlich verrückt gewesen sein muß, was jetzt – nach seinem Sturz – so richtig klar wird. Damit das alles als zivilisatorische Mission des Mutterlands von egalite, liberte und fraternite so recht zur Geltung kommt, verschweigt die freie Presse einstweilen einmal nichts über eine der Kreaturen des Imperialismus in Afrika. Was nicht heißt, daß sie die Wahrheit über den Imperialismus ausplaudern würde. Dieser geht gerade durch das Auswechseln lästig gewordener Figuren seinen gewohnten Gang. Da unten und hier oben, bei uns.
II. Entscheidung in London – Ein Kampf um Zimbabwe
Inzwischen scheint die Zeit reif für eine Lösung in Zimbabwe, die auch diesem Land, wenn auch mit Verspätung, eine geregelte Entkolonialisierung bescheren dürfte. Bekanntlich war sie 1965 ins Stocken geraten durch die Weigerung des weißen Siedlerregimes, die „Kaffern“ dergestalt an der Macht zu beteiligen, daß das gleiche Stimmrecht für alle als Grundlage freier Wahlen von der ,,Rhodesian Front“ des Ian Smith anerkannt worden wäre. Das zähe Festhalten der weißen Rhodesier an der für sie sicheren Alleinherrschaft über das Land –, riesige Plantagen mit spottbilliger schwarzer Arbeitskraft, ein Herrenleben mit einer bunten Dienerschar und die Finanzierung des Staatshaushalts, also der Unkosten von Herrschaft durch den Export von Chrom, Gold und Asbest – stand im Widerspruch zu dem Interesse des Mutterlands an Entkolonialisierung, das von den imperialistischen Konkurrenten unterstützt wurde.

Dem unabhängigen Staat Rhodesien sollten die Kosten der Herrschaft übertragen und dieser zugleich so eingerichtet werden, daß der schrankenlosen Erschließung der natürlichen Reichtümer und dem Aufbau einer lukrativen, rohstoffverarbeitenden Industrie nichts im Wege stand. Die „Halsstarrigkeit“ seiner eigenen Landsleute stellte Großbritannien vor die Aussicht einen ständigen Unruheherd in einer strategisch wichtigen und für den Rohstoffbedarf der westlichen Welt entscheidenden Gegend Afrikas am Hals zu haben. Während noch im Burenkrieg die Kolonialmacht den Widerstand weißer Siedler mit einem Expeditionskorps brach, erledigen in unserer Zeit die Betroffenen die Angelegenheit unter sich, was nicht heißt, daß sie sie alleine ausmachen: der freie Westen demonstrierte, daß der Rassismus nur dann seine Waffe ist, wenn er das Geschäft fördert, warf Smith und den seinen Rassismus vor und verhängte über die abtrünnige Kolonie einen Handelsboykott, den er an den Stellen einhielt, wo er das Smithregime allein traf (Export der Agrarprodukte, Import von Gegenständen des gehobenen Bedarfs) und genau da konsequent brach, wo er auf das Zeug aus Rhodesien scharf war. Auf der anderen Seite gewährte er den von Smith ausgebooteten Negerführern finanzielle und moralische Unterstützung und ließ es zu, daß die Staaten des realen Sozialismus die Waffen stellten. Wo Geld und Waffen vorhanden sind, finden sich auch Kämpfer, zumindest in Gegenden, wo eine warme Mahlzeit, eine Uniform und die Aussicht, nach dem Sieg eine Staatsstelle zu kriegen, immerhin eine Alternative darstellen zum Dahinvegetieren in Hunger und Elend. Der Guerillakrieg zerstörte in Rhodesien genau jene gesicherte Qualität des Lebens, um deren Erhaltung Smith abgefallen war. Andererseits versetzte seine Armee, in der übrigens zu 90 % schwarze Zimbabwer aus den gleichen Gründen kämpfen wie in den Reihen der Patriotischen Front, den Nachbarstaaten, die von der Guerilla zum Hinterland ihres Krieges gemacht wurde, derart, empfindliche Schläge, daß sie auf der Commonwealth-Konferenz von Lusaka Margaret Thatcher versprachen, die Herrn Nkomo und Mugabe an einen Tisch mit Smith und Muzorewa zu bringen. Der Krieg hatte also genau den Erfolg, auf den Großbritannien spekuliert hatte: ein paar massakrierte und zahlreiche emigrierte weiße Farmer, an die vierzigtausend tote Afrikaner in Zimbabwe und ungezählte mehr in Mosambik und Sambia, und die Todfeinde sitzen um den runden Tisch und akzeptieren Bedingungen, wegen deren Ablehnung der Krieg einmal angefangen hat. Und die ganze Veranstaltung läuft unter der inoffiziellen Schirmherrschaft der Republik Südafrika, die auf ihrem Territorium die Schwarzen in Homelands pfercht und mit der Apartheid als Lohnsklaven niederhält, an der Nordgrenze aber mit den Negern stabile Verhältnisse haben will.
Daß am Ende der Geschichte Joshua Nkomo den Chefposten in Salisbury einnehmen wird, daran zweifelt unter den Interessenten und den interessierten Beobachtern fast niemand. Im Gegensatz zu Muzorewa hat er im Poker um die besseren Posten staatsmännische Geduld bewiesen und Smiths Angebot der Regierungswürde ohne Macht zurückgewiesen. Jetzt kann es dem Bischof passieren, daß er demnächst von Sambia aus eine Freischärlertruppe kommandiert, wie schon vor 5 Jahren, als Nkomo mit Smith über eine „interne Lösung“ verhandelte und Muzorewa auf den ,,langanhaltenden Befreiungskrieg“ setzte. Außer den revisionistischen Verehrern afrikanischer Freiheitshelden bereiten die ständigen Frontwechsel dieser Figuren ohnehin niemandem Schwierigkeiten.
Die weißen Rhodesier haben erfahren müssen, daß die Geschäfte des Imperialismus in Afrika auch ohne sie laufen, (ein Blick über die Grenzen hätte es sie auch lehren können) und daß ihr Mutterland ihnen die Herrschaft auch verleiden kann, wenn sie nicht bereit sind, die süßen Opfer eines vollentschädigten Herrschaftsverzichts zu bringen, welche das Weltinteresse gebietet. Ihr Massenexodus unter schwarzer Herrschaft ist eingeplant, über die Höhe der Entschädigung wird schon verhandelt, Eigentumsgarantien für die Verbleibenden sind vorgesehen, damit die paar Weißen, die es braucht, um einen brauchbaren Afrikastaat aufzuziehen, bleiben werden.
Dagegen zählen Zehntausende von Stammeskriegern, die in den Scharmützeln für ein „sozialistisches“ oder ein „prowestliches“ Zimbabwe gefallen sind, nicht einmal zu den faux frais der Weltpolitik: sie haben ohnehin nie erfahren, wo Moskau liegt und wo Washington.
PS: Auch der KBW wird seine 20 LKWs für Robert Mugabes ZANU nicht als Fehlinvestition abbuchen: Immerhin gibt es demnächst ein unabhängiges Zimbabwe, für „Genossen Mugabe“ entweder einen Posten oder den posthumen Ruhm eines Märtyrers für den Sozialismus in Afrika.
III. Die Freiheit in Nicaragua – Ein neuer Partner für die USA
Die ersten wegweisenden Maßnahmen der siegreichen Sandinistischen Befreiungsfront bestanden im Vorzeigen einer 5-köpfigen Regierungsjunta, in der nur ein sandinistischer Guerilla Anlaß gab, ihn kommunistischer Sympathien zu verdächtigen, sowie der Versicherung an die USA, mit der Beseitigung Somozas sei der Grund beseitigt, der freundschaftliche Beziehungen beeinträchtigen könne.
Wenn das linke Junta-Mitglied Moises Hassan(1) mit der neu errungenen Souveränität prunkt – „Vom internationalen Gesichtspunkt aus wird bzw. ist Nicaragua das erste Mal in seiner Geschichte ein unabhängiges Land. Wir sind dabei, Beziehungen mit allen Ländern aufzunehmen, mit denen wir Beziehungen haben wollen.“ (Interview in „Rote Blätter“, September 1979) –, so präzisiert die Junta, daß vor allem die USA und der Westen zu den Staaten zählen, mit denen sein Land jetzt „Beziehungen“ erneuern will, die Somoza verbrecherischerweise dazu mißbraucht habe, nur sich zu bereichern. |
 |
Mit dieser Argumentation dementiert die FNLS selbst Gerüchte, bei ihrem Aufstand habe es sich um einen Kampf gegen den US-Imperialismus gehandelt: Nicht der Auftraggeber, ohne den es keinen Somoza gibt, dessen Regime den reibungslosen Abtransport aus Nicaragua und die Ausbeutung des Arbeitsviehs mit der Nationalgarde nur solange regeln konnte, als die USA den Diktator finanzierten und seine Truppe ausrüsteten und ausbildeten, wird kritisiert. Stattdessen bietet man sich selbst als den neuen Prokuristen an.
7 Mio. Dollar in der Staatskasse bei 3 Milliarden DM Auslandsschulden, ein jährlicher Importbedarf an Lebensmitteln von einer Milliarde, um nur das 1500-Kalorien-Niveau pro Kopf und Tag der Somozazeit zu halten, das sorgt für eine die künftige Zusammenarbeit fördernde Vernunft, der sich die neuen Herren bereitwillig unterwerfen. Die ,,Süddeutsche Zeitung“ läßt einen Sandinista zu Wort kommen, der ihren Lesern bestätigt, daß die Junta schon aus ökonomischen Überlegungen den Westen nicht durch eine Rache an den Besiegten verprellen will, weil sie sich das wirtschaftlich gar nicht leisten kann:
„Anders als Persien hat Nicaragua kein Erdöl, auch sonst keine Reichtümer; wir sind auf die Hilfe des Westens angewiesen. Da können wir uns keine Erschießungspeletons leisten.“
So wird aus dem Entschluß der Sieger, auf Abrechnung mit den ehemaligen Unterdrückern zu verzichten, ein ökonomisches Kalkül pfiffiger Habenichtse; andererseits wird die abwartende Stellung gegenüber einem Land bestätigt, das zwar einen Freund des Westens davongejagt hat, dennoch aber Freund bleiben möchte. Doch Freundschaft ist teuer, wenn man nichts hat: dafür hat die Junta, noch ehe ein Dollar der erbetenen Hilfe locker gemacht wurde, schon vertrauensbildende Vorleistungen erbracht:
„Ausländischer Besitz wird nicht angetastet, auch nicht die Plantagen der berüchtigten United Fruit Company.“ („Südd. Zeitung“)
Stattdessen hat die neue Regierung die Rechtsnachfolge Somozas angetreten und ihren Willen erklärt, alle sich daraus ergebenden Verpflichtungen zurückzuzahlen. Als Gegenleistung für magere 30 Mio. Dollar US-Hilfe setzt Nicaragua alle joint-venture-Unternehmen mit US-Kapital fort, so daß die Plantagen und das bißchen Industrie jetzt über Aufsichtsräte verfügen, in denen amerikanische Manager gemeinsam mit Sandinistas die Wiederaufnahme der Produktion anleiten. So ist der Optimismus der neuen Machthaber nicht übertrieben, daß binnen 5 Jahren das alte Produktions- und Exportvolumen wieder erreicht sein wird. Um jene 90 % des Exportwerts bereitzustellen, den Nicaragua durch Verkauf von Baumwolle, Zuckerrohr, Kaffee und Fleisch erzielt, werden sich die Landarbeiter, wenn sie überhaupt Arbeit bekommen, auf den großen Plantagen weiterhin mit ihrem Nationalgericht Yucca, einem Wurzelgemüse, begnügen müssen. Die ausschließlich für den Inlandsmarkt produzierende Industrie wird ihre Hungerlöhne nicht erhöhen, um die Gewinne der nationalen Bourgeoisie hoch genug zu halten, damit sich für sie die ,,Revolution“ gelohnt hat, die sie und die Kaufleute mit einem „Generalstreik“ von oben ausgelöst haben.
Wenn Moises Hassan schwärmt:
„Wir müssen das Bewußtsein und die revolutionäre Begeisterung aufrechterhalten, die während des Kriegs und im Widerstand erstanden sind, da wir uns darüber im Klaren sein müssen, daß wir zwar einen militärischen Sieg errungen haben, aber der Kampf um den Wiederaufbau des Landes eine schwierige Aufgabe ist“,
so appelliert er an die Plantagenarbeiter und die Taglöhner von Managua, die vorwiegend in Kleinbetrieben je nach Auftragslage ein- und wieder ausgestellt werden, nicht dem Mißverständnis aufzusitzen, durch den Sturz Somozas beginne für sie der Aufstieg. Die Massen der Gelegenheitsarbeiter in den Slums von Managua und der Bauern, die vom Großgrundbesitz expropriiert werden und deshalb durch Urwaldrodung sich neue, kaum subsistenzfähige Bodenstücke erschließen, auf denen sie so lange schuften, bis sie von nachrückenden Plantagenbesitzern wieder vertrieben werden, müssen hingegen eher in ihrer ,,revolutionären Begeisterung“ gedämpft werden. Den Campesinos, die nach der Enteignung des Somoza-Grundbesitzes ein Stück Land zum Leben forderten, wurde klargemacht, „daß Baumwoll- und Kaffeeplantagen als Kleinbetriebe nicht rentabel sind“, also der Staat nun „der größte Unternehmer des Landes“ auf die gleiche Weise Gewinne aus dem Lande ziehen will wie Somoza: Kaffee und Baumwolle für Amerika, Wurzeln für die Massen.
Die Hacienda Nicaragua der Somoza Inc. hat den Besitzer gewechselt und die neuen Herren gedenken sie mit dem alten Partner besser zu bewirtschaften. Dazu gehört auch das Vorgehen gegen jede Regung der Befreiten, nach der Siegesfeier jetzt auch wirklich was zum Feiern zu kriegen:
„Die »radikalen« Gruppierungen nutzen auf ihre Art und Weise die Nöte, den Kummer und die Sehnsucht des nicaraguanischen Volkes für sich aus, um Chaos zu produzieren, um auf eigene Faust loszugehen ... Sie gefährden durch ihre Aktionen die Produktion, die Rekonstruktion und das internationale Ansehen der Revolution.“ (Hassan)
Kein Wunder, daß zu den ersten sichtbaren Aufbauleistumgen der Junta die Aufstellung einer ,,humanistischen Polizei“ und der Aufbau einer Volksarmee, deren Offiziersränge von den ehemaligen Freischärlern bekleidet werden, zählen. Die sandinistische ,,Nationale Befreiungsfront“ hat gesiegt. Was für ein Sieg? Befreiung wovon? Eine neue Flagge, eine neue Hymne für die gleiche Nation. Ein neuer Staatsapparat bislang ohne Terror gegen die Bevölkerung, von der man erwartet, daß sie die Not, die bislang die Gewalt erzwang, freiwillig erträgt, weil der Abzug der Schergen des alten Regimes und der Frieden nach den Zerstörungen des Bürgerkriegs die unmittelbare Bedrohung von Leib und Leben beseitigt hat. Die neuen Herrscher der Nation richten sich auf dieser Grundlage ein und machen sie zur Basis ihres politischen Programms.
„Für unsere Entwicklung spielt es eine wichtige Rolle, daß wir nun die ökonomischen Mittel besitzen, um unsere politischen und sozialen Ziele zu realisieren.“
Der alte Revi-Spruch, daß die Ökonomie Mittel der Politik ist und daß das der Sozialismus sein soll, ist besonders unter nicaraguanischen Verhältnissen ein Zynismus ohnegleichen: eine Politik, die sich die vom Imperialismus für seine Zwecke hergerichtete Produktionsweise zum Mittel machen will, macht sich zu deren Mittel und besorgt das alte Geschäft. Die ,,Revolution“ besteht also darin, daß die Tantiemen für die ortsansässige Herrschaft neu verteilt werden, weswegen diese Revolution im Westen eine bleibend gute Presse hat.
IV. Die Mullahs an der Macht – Unvernunft im Iran
Die Lage im Iran befriedigt dagegen so recht niemanden: die bürgerliche Öffentlichkeit registriert einerseits zwar erleichtert die Wiederaufnahme der Ölförderung, die Erklärungen der Regierung und des Ayatollah, die ökonomischen Beziehungen zum Westen fortzuführen und auf bestimmten Gebieten sogar auszubauen, und die stramm antikommunistischen Erklärungen der neuen Machthaber, denen inzwischen auch schon Taten gefolgt sind.
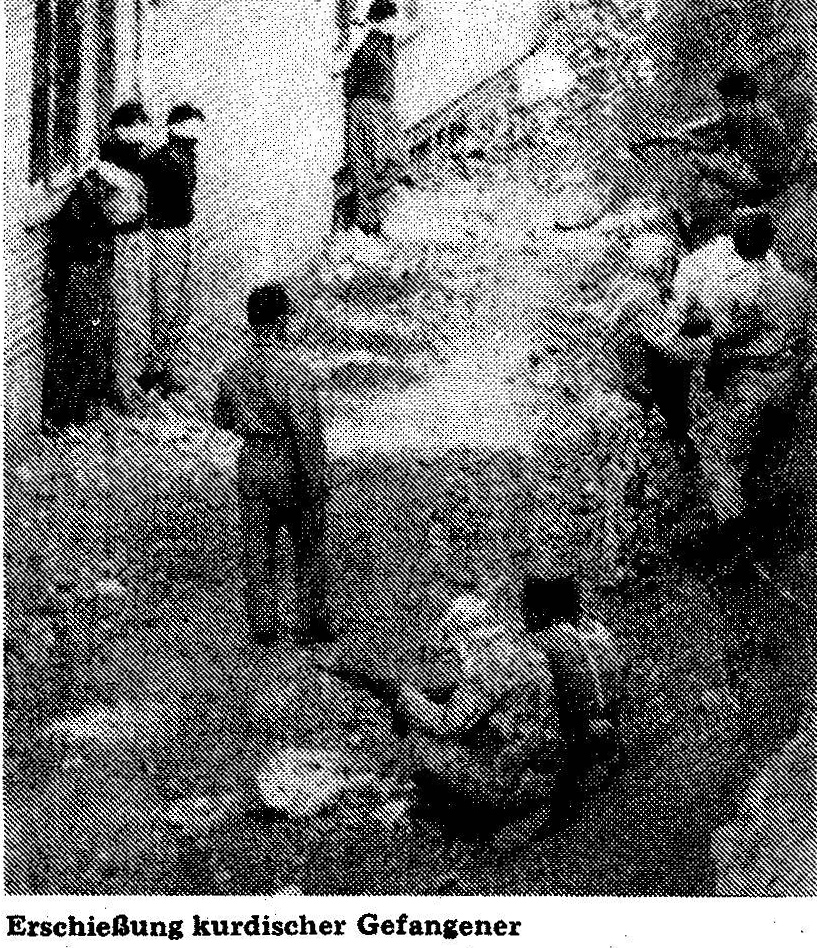 |
Selbst die Niederschlagung des Kurdenaufstandes stößt auf das Verständnis realpolitischer Kommentatoren, die darauf hinweisen, daß ein Staat schließlich sein Territorium zusammenhalten müsse und der Abfall Kurdistans Konsequenzen in anderen Provinzen nach sich zöge, so z.B. in der Ölregion Khusistan am Persischen Golf. Entsetzt gibt man sich aber darüber, daß die Mullahs Ernst machen mit der Islamisierung des öffentlichen und des privaten Lebens und der Justizayatollah Khalkali genießt in den Medien ein Image wie der mittlerweile in Pension gegangene Idi Amin, obwohl die Aktivitäten seiner Revolutionsgerichte vergleichsweise bescheiden sind verglichen mit dem, was der Schah und seine SAVAK auf dem Gebiete der Leichenproduktion leisteten. Gegen Tote in der Politik hat man grundsätzlich nichts einzuwenden. Im Iran hingegen werden sie immer noch kritisch registriert, weil man den Prinzipien mißtraut, denen sie zum Opfer fallen. Beim Schah, das ist sicher, herrschte hier Klarheit. |
Die Linken, in den Anfängen noch Parteigänger der islamischen Revolution, sind verunsichert: Hinrichtungen, sofern sie von der gerechten Rache des Volkes gedeckt sind, verwechselt man im Lager des Revisionismus allemal mit dem Sturz der herrschenden Klasse, und was die Außenpolitik betrifft, so konnte man je nach Zugehörigkeit zur Moskauer oder Pekinger Zentrale die Anti-USA oder die sowjetfeindlichen Sprüche registrieren. Was in dieser Ecke Skepsis aufkommen läßt, ist der immer klarer zutage tretende Sachverhalt, daß die Islamische Republik mittlerweile so ziemlich alle Programmpunkte mit Füßen tritt. Dabei lügt man sich geflissentlich über den Punkt hinweg, daß es sich um das eigene Programm handelt, das hier malträtiert wird, Khomeini hingegen sich von A bis Z treu geblieben ist: in der Frauenfrage, die für ihn nie eine war, in der Kurdenfrage, die er mit dem Islam beantwortet (die Kurden sind Irrgläubige), in der Frage der außenpolitischen Beziehungen:
,,Saudi-Arabien und Iran streben die gleichen Ziele an. An erster Stelle steht dabei die Stärkung und Ausbreitung des Islam.“ (Der iranische Botschafter in Er Riad, nach ,,Süddeutsche Zeitung“ vom 9.10.)
Was beide Seiten beunruhigt, ist die Unberechenbarkeit der Ayatollahs für das jeweilige Kalkül: für die Parteigänger des Imperialismus bleibt der Antikommunismus eine unsichere Sache, wenn er vom Standpunkt des Islam nicht nur vorgetragen, sondern auch praktiziert wird. So wirbt eine Häuserdichtungsfirma mit dem Porträt des Ayatollah für ihr Energiesystem, weil man auf die Furcht spekuliert, die iranischen Machthaber würden ihr Öl in der Wüste lassen, nur um die Islamisierung Jerusalems durchzusetzen. Während die Ölprinzen Saudi-Arabiens Religion, Geschäft und Politik durchaus auseinanderzuhalten wissen, nichts dabei finden, zu Hause einem Schnapstrinker die Gurgel durchzuschneiden und gleichzeitig auswärtig in Brauereiaktien zu machen, schreckt ein ,,Fanatiker“ wie Khomeini nicht davor zurück, eine ganze Generation von Ärzten, Ingenieuren und Lehrern, die dringend benötigt würden, zu lebenslangen Arbeitslosen zu machen bzw. sie ins Exil zu treiben, weil er ihrer westlichen Erziehung mißtraut.
So wird auf einem Umweg die Lage der persischen Massen entdeckt: an ihrem Elend, das einem zu Zeiten der Pahlevis herzlich gleichgültig war, wird der Wirtschaftspolitik der Mullahs das baldige Desaster prophezeit. Durch und durch materialistisch diagnostiziert man, daß die islamische Begeisterung den Hunger nicht überstehen wird und fürchtet dabei nur das eine, daß nämlich die Islamische Republik nicht imstande sein wird, langfristig 5 Mio. Barrel Erdöl pro Tag für den westlichen Bedarf bereitzustellen. Khomeini hat die Organisation der gesamten iranischen Ökonomie und des sie aufrechterhaltenden Staates um die Bohrlöcher von Khusistan mit keiner einzigen seiner Maßnahmen verändert, er hat sie lediglich unsicher gemacht und unberechenbar. Kein Wunder, daß im Westen über die Chancen für ein Comeback des Schah oder die Zeit nach Khomeini spekuliert wird.
Die islamische Revolution tut einstweilen ihr möglichstes, um eines sicherzustellen: die Herrschaft des Islam in Gestalt der Mullahs. Der Ayatollah finanziert seine Hausarmee, die Pasdaran, und längst gibt es wieder einen Geheimdienst, der nicht mehr SAVAK heißt, sondern ,,Augen des Koran“.
Die gewonnene Unabhängigkeit von den Aufgaben, die der US-Imperialismus seinem „Wachhund am Golf“ übertragen hatte, und wofür er das Schahregime mit den Petrodollars finanzierte, nützt der Ayatollah für Versprechungen an alle islamischen Regierungen und Bewegungen in der Welt, wobei er sich durchaus nicht dogmatisch verhärtet zeigt: mit iranischem Geld kaufen die afghanischen Moslemrebellen Waffen im Westen gegen ihre moskaufreundliche Regierung, während die PLO aus der gleichen Quelle die Mittel bezieht, um in der CSSR Maschinengewehre zu ordern. Das Geld des Ayatollahs hingegen fließt unverändert vor daher, von wo es der Schah bezog, dessen Erschliessung das Lebenswerk Khomeinis nach eigenem Bekunden krönen soll. Solange die panislamische Außenpolitik des Ayatollahs bei den moslemischen „Bruderstaaten“ auf wenig Gegenliebe stößt, die Fördermenge des Öls konstant und die Grenze zur SU dicht bleibt, kann der Imperialismus damit leben.
______________________________
(1) Diese heute völlig vergessene Figur der Sandinistischen Revolution war ein prominentes Mitglied der sandinistischen Junta und später Bürgermeister von Managua. In den 80-er Jahren wandte er sich von den Sandinisten ab und wurde zu einem Parteigänger von Violeta Chamorro.
Wie aus diesem Artikel hervorgeht, ergab sich die Feindschaft der USA gegenüber den Sandinisten gar nicht aus deren Programm, sondern aus dem sehr prinzipiellen Beschluß der USA, dergleichen eigenmächtige Machtergreifungen in ihrem Hinterhof keinesfalls zu dulden.
aus: MSZ 31 – Oktober 1979