Niederlage der USA in Indochina:
Ein demokratischer Journalist beherrscht sein Handwerk, wenn er seine Parteilichkeit für den demokratischen Staat in ausgewogene Stellungnahmen zu kleiden versteht. Am Fortbestand kapitalistischer Verhältnisse interessiert, darf er in seiner Freude über die Funktionstüchtigkeit des demokratischen Staats nicht die Gefahren vergessen, die ihm drohen. Wenn er an einem Ereignis die Vorteile herausstreicht, die der Staat aus ihm zu ziehen vermag, so nicht ohne vor den Nachteilen zu warnen, die dasselbe Ereignis für den Staat mit sich bringen kann. Seine Ausgewogenheit besteht also darin, überall zwei Seiten zur Kenntnis zu nehmen und stets Vor- und Nachteile einer Sache gegeneinander abzuwägen, wenn er den Standpunkt des demokratischen Staats verkündet. Für die Beurteilung internationaler Politik bedeutet das die schwierige Aufgabe, in den Handlungen anderer Staaten den Nutzen oder Schaden des eigenen Staats aufzuspüren. Bei der Beurteilung innenpolitischer Ereignisse sind Journalisten Politikern gegenüber im Vorteil, denn sie unterliegen in ihren Überlegungen nicht den Beschränkungen, denen die Politiker in ihrem Handeln ausgesetzt sind. Sie können sich Vorteile für den Staat erdenken, die sich aufgrund des Widerstands derer, für die sie Nachteile bedeuten, noch nicht haben verwirklichen lassen, oder aber drohende Nachteile für den Staat an die Wand malen, um die Staatsbürger zur Beschränkung zu bewegen, deren Vorteilhaftigkeit sie im Vergleich mit dem möglichen Staatsschaden erkennen sollen. Die Journalisten eilen so den Politikern voraus, sie sind die Schreibtischtäter, die mit ihren staatsdienlichen Begründungen Hilfestellung für politische Entscheidungen leisten, die stets auf Kosten der Staatsbürger gehen.
Der Schein, die Journalisten seien keine freiberuflichen Staatsangestellten, kann also nur deshalb entstehen, weil die Journalisten in ihrer Parteinahme für den Staat sich zu dessen Vorteil auch kritisch zu ihm äußern (weshalb sie von den Politikern gefürchtet werden), und weil sie ihrer Parteilichkeit auch dort freien Lauf lassen können, wo die praktischen Politiker sich noch Schranken auferlegen. Im Gegensatz zu jenen Staatsbürgern, die sich eine Meinung zulegen müssen, um den Schaden auszuhalten, den ihnen der Staat zufügt, die also – weil sie den Staat brauchen – alle Handlungen des Staats in Bezug auf den eigenen Nutzen oder Schaden betrachten und sich mit ihrer (wohlwollenden oder kritischen) Meinung über den Staat zufriedengeben, haben die Journalisten die schäbige Aufgabe, die öffentliche Meinung zu bilden, das Einverständnis der Bürger mit dem Staat aufrechtzuerhalten oder herzustellen, indem sie die Bürger beschimpfen. Als 5. Kolonne des Staats ist ihnen dabei kein Argument zu säuisch.
Yankee, was nun?
Trost & Rat für die Weltmacht in der Weltpresse
1. Journalisten beweisen ihren Realitätssinn
| Ein Journalist, der sein Handwerk gelernt hat, kann an den jüngsten Ereignissen in Südostasien zeigen, was er kann. Schließlich ist der Weltmacht USA dort eine Niederlage bereitet worden, die offenkundiger nicht sein könnte. Dem Leser, der vielleicht Befürchtungen hegt, daß diese Katastrophe Auswirkungen auf sein Wohlergehen haben könnte, wird als erstes geraten, erleichtert aufzuatmen: man ist jetzt endlich „vom Alpdruck Vietnam befreit“ (Borch in der Süddeutschen Zeitung vom 23., 13. 4. 75) –, und die ganze Sache in stoischer Gelassenheit zu betrachten: | 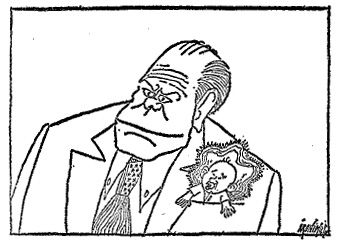 |
Schließlich nahm dort nur das „Unabänderliche“ (Spiegel Nr. 15) „unvermeidlich“ (Sebastian Haffners Meinung im Stern Nr. 16) und „unausweichlich“ (Spiegel) seinen Lauf. Solchem Realitätssinn pflegt man gewöhnlich dadurch Nachdruck zu verleihen, daß man die Natur als Vergleichsmaterial bemüht: auch bei geologischen Formationen geht es nie ohne Erdbeben ab (Schwelien beim ARD-Frühschoppen am 13. 4. 75) und faule Früchte haben die Eigenschaft zu fallen („Da Nang fiel wie eine faule Frucht“ SZ v. 1. 4. 75). Und wenn man eine Katastrophe, eine Tragödie, ein Desaster oder auch nur ein „Teil-Debakel“ (Schlesinger) vor sich hat, dann darf man nicht nur, nein dann muß man lamentieren:
„Die Schreckenstaten, die das Ende eines langen und schrecklichen Bürgerkriegs zu begleiten pflegen, können wir beklagen, nicht verhindern.“ (Haffner)
Man kann aber noch mehr tun: den schicksalsgetroffenen Bündnispartner in der Stunde seiner „Heimsuchung und Anfechtung“ (Höfer) nicht im Stich lassen, sondern ihm Trost zusprechen:
„Sagen wir es laut, daß ihm unsere Sympathie gehört, selbst an dieser Stelle, wo es stört.“ (Christian Morgenstern)
Das Handeln, nach der „zu jener Zeit im Westen konventionellen Weisheit“, daß Aggression nicht ungestraft bleiben“ durfte, war nicht nur richtig“ (Spiegel) sondern verdient besondere Anerkennung:
„Das amerikanische Eingreifen nahm sich in diesem Lichte (der konventionellen Weisheit – MSZ Koll.) keineswegs als imperialistisches Manöver aus, sondern als liberale Intervention, die Südvietnam die Zukunftschance einer pluralistischen Demokratie verbürgen sollte. – Jene, die damals so dachten, brauchen sich ihres ursprünglichen Impulses auch heute noch nicht zu schämen.“ (Theo Sommer in der Zeit Nr. 15)
Gerade „wir Europäer dürfen die Amerikaner nicht mit erhobenem Zeigefinger kritisieren“ (Höfer); schließlich „war die Entscheidung vorgeschrieben“ :
„Nixon und Kissinger hatten gar keine Wahl. Entweder sie mußten(?) Nordvietnam mit Atombomben auslöschen, dann waren die Folgen(!) unabsehbar; oder sie mußten weiter Geld in ein Faß ohne Boden schütten und einen Krieg fortsetzen, der mit irgend kalkulierbaren Mitteln nicht zu gewinnen war.“ (Augstein im Spiegel Nr. 15)
– vielmehr sollten wir uns freuen, daß sie jetzt endlich Vernunft annehmen:
„Das Ende des Endes hat über fünf Jahre gedauert: Daß Amerika seine Übermacht jetzt nicht einsetzt (Zwischenfrage Augstein: Sie meinen doch nicht etwa die Atombombe?), um es nochmal abzuwenden, sollte ihm moralisch angerechnet nicht vorgeworfen werden.“ (Borch)
2. Das große Rätselraten oder: Das Lösen der Schuldfrage
Nachdem man so seine Pflicht getan hat und das Handeln der Amerikaner als liberale Intervention verteidigt hat, das Zukunftchancen eröffnet, macht man sich jetzt ans Vergnügen und befriedigt die Neugier des Lesers. Zwar ist ihm bereits klar, daß Vietnam ein schicksalhaftes Naturereignis darstellt, aber er will doch wissen, ob es nicht auch für so etwas einen Verantwortlichen gibt. „Die Frage nach dem Schuldigen“, die schon einmal versäumt wurde – sie „erstickte im Jubel um die heimgekehrten amerikanischen Kriegsgefangenen“ (Spiegel 15) –
muß endlich gestellt werben, um ähnliche unvermeidliche Debakel zu vermeiden. Man fragt also „Wieso, warum?“ (Sommer), und gibt im gleichen Atemzug zu verstehen, daß die ganze Fragerei nichts als ein Unterhaltungsspiel ist, bei dem – aufgrund der Frage Stellung – die richtige Antwort nicht mal als Zufallstreffer zu ziehen ist.
„Die Welt ist aufs Rätseln angewiesen.“ (Sommer)
Und so gibt es denn so viele Schuldige wie Frager.
a. Die Politiker haben versagt
Da sind zuerst jene amerikanischer Politiker, die „die Politik der Eindämmung der Sowjetunion“ von Europa, wo sie „erfolgreich“ war, auf die „asiatische Gesellschaft“ ausdehnten, wo sie „nicht nur unmöglich, sondern auch überflüssig“ war (Borch). Wenn die Amerikaner Sebastian Haffners Meinung gekannt und sich ihrer Herkunft besonnen hätten, wäre sicher nichts schiefgegangen:
„Amerika hat in Europa ... im ganzen erfolgreich und auch segensreich gewirkt. Dagegen sind Amerikas Versuche auf Asien missionarisch einzuwirken, auch die gutgemeinten (!), fast immer danebengegangen … Das ist kaum ein Zufall. Die Amerikaner sind schließlich die Abkömmlinge von Europäern, mit einer kleinen Beimischung von Afrikanern (Chinatown? – MSZ-Koll.).“
Und auch der Spiegel plädiert für die Mission an Themse, Rhein und Po:
„Die Frage nach dem Schuldigen für die Kreuzzugsideologie, nach der die Freiheit der Welt angeblich am Mekong verteidig! werden sollte ...“
Hoffentlich wird der Ideologe bald verhaftet, damit er nicht noch mehr Schaden anrichten (der Spiegel soll ja ein hervorragendes Informationswesen haben) kann.
Dann gibt es die Verantwortlichen im Weißen Haus, die Amerika einfach zu viel zumuteten:
„Der Konflikt überstieg auf die Dauer das Leistungsvermögen selbst der Vereinigten Staaten ...“ Nicht die Motive für Intervention entpuppten sich denn als unzureichend und unzumutbar, sondern vielmehr ihre Mittel und Möglichkeiten.“ (Sommer)
Hier aber kommt die „Rheinpfalz“ mit der gegenteiligen Meinung: die Amerikaner hätten durchaus gekonnt, wenn sie nur gewollt hätten:
„Die mächtigste Weltmacht hat von ihren Möglichkeiten und Pflichten oft nicht den richtigen Gebrauch gemacht ...“
Doch da gaben Stern und Spiegel das mangelnde prognostische Vermögen der Politiker in allen Entscheidungen zu Bedenken:
„Amerika nahm die unverhofften militärischen Erfolge der Süd-Armee staunend zur Kenntnis, im Weißen Haus begann sich wieder einmal die Meinung durchzusetzen, die Vietnamisierung des Krieges sei doch möglich.“ (Spiegel 15)
„Die letzten großen Offensiven in Vietnam fanden 1968 und 1972 statt, also(!) wird wohl aller Voraussicht nach(!) die nächste größere erst 1976 kommen.“ (Schlesinger zitiert nach Stern 16)
b. Der Verbündete war der Verkehrte
Jetzt aber kommen die Südvietnamesen an die Reihe. Mit wem hat man sich da bloß eingelassen. Wenn auch ihr „Staatsgebilde durchaus existenzberechtigt“ (SZ v. 1. 4. 75) war, so blieb doch „die Eigenanstrengung der Südvietnamesen unzureichend, ihre Motivation dürftig“ (Sommer). Warum übernahmen sie nicht die zumutbare und zureichende Motivation der Amerikaner? Stattdessen wälzten sie einfach die Last zur Erhaltung ihres staatlichen „Kunstgebildes“ (Haffner) auf die Schultern der Amerikaner – und als diese nicht mehr konnten, gaben sie sich kurzerhand selbst auf: zwei Jahre nach dem Abzug der Amerikaner war ihr „Lebenswille zerbrochen“ (SZ v. 1. 4. 75). Wie schlimm es um die Moral der Bevölkerung bereits bestellt ist, belegt die Vermutung, daß sie selbst das Eigentum eines Auslandskorrespondenten der Süddeutschen Zeitung nicht respektieren wird:
„Aber was werden meine Jungen Beschützer, meine Milizionäre machen, wenn die Stunde Null geschlagen hat? Werden sie kämpfen? Oder werden sie mir meine Schreibmaschine wegnehmen und davonlaufen? Das zweite kommt mir wahrscheinlicher vor.“ (Widmann in der SZ v. 12./13. 4. 75)
Auch die Armee machte eine seltsame Wandlung durch:
„von der »perfektesten Kriegsmaschine Asiens« zur davonlaufenden und marodierenden Soldateska, und dann noch einmal, zum halb teilnahmslosen, halb hysterischen verlorenen Haufen'.“ (Widmann)
Daß solch eine moralisch verrottete [„brutale Rücksichtslosigkeit“, „kannibalische Grausamkeit“ (Sommer)] Armee nicht der Kommunisten Herr werden konnte, die durch „die Verschmelzung von Kommunismus mit Patriotismus und Nationalismus“ (Haffner) sowie durch ihre Unauffälligkeit –
„Jeder, der nicht als lupenrein gilt, (wird) auf der Stelle erschossen. Wer sich auffällig verhält, wird als Vietkong verdächtigt: Das Dumme(!) daran ist nur, daß die echten Vietkong sich am unaufälligsten verhalten.“ (Widmann) –
an sich schon „unbesiegbar“ (Haffner) waren, verwundert jetzt nicht mehr. Und auch die Korruptheit der amerikanischen Marionetten ist heute keinem mehr ein Problem:
Thieu, der „durchdrehte“ (US-Berater in Saigon laut Spiegel 15), den Rückzug anordnete, ohne ihn von den Amerikanern gelernt zu haben:
„Ein geordneter Rückzug aber ist eines der schwierigsten militärischen Manöver. Und das hatten wir den Südvietnamesen nicht beigebracht – sie konnten es also nicht.“ (US-General laut Spiegel 15) – und Lon Nol, „dieses Monument des Unvermögens, der weder zum Kriegführen noch zum Friedenschließen taugte“ (SZ v. 1. 4. 75),
flog nach Indonesien aus –
„Warum haben es die Amerikaner – die es doch mit der Nichteinmischung in die .inneren Angelegenheiten' Kambodschas nie sehr genau nahmen – ihn nicht schon früher von der Bühne abgeschoben? Ihn an der Macht zu dulden(!), war grobe Fahrlässigkeit.“ (SZ v. 1.4. 75)
Soll das heißen, daß nicht diese beiden schlechten Menschen, sondern fahrlässige Amerikaner die Schuldigen sind? Diese streiten aber alles ab und lassen durch ihren Pressesprecher Ron Nessen verkünden, daß „das nicht unser Krieg ist".
c. Amerika läßt Vietnam im Stich
Da ihm dies aber heute keiner mehr abkauft, muß in Amerika weitergesucht werden, wo sich noch viele Schuldige finden lassen.
Der Spiegel macht als „Hauptbetroffenen“ Henry Kissinger ausfindig, der sich – anstatt sich um Vietnam zu kümmern – „ganz der Vorbereitung seines Auftritts vor den Nato-Partnern in Brüssel widmet“ (eitel war er ja schon immer); der die „Chance des decent interval“ vertut, indem er – typische „Kissinger-Logik“ – „mehr Krieg führen läßt, um eher Frieden zu kriegen.“ Dann der Kongreß, der von Kissinger angeklagt wird, einen Verbündeten vorsätzlich zu zerstören, da er die Bewilligung der Militärhilfe für Vietnam verweigert.
Doch er tut nur, was die amerikanische Bevölkerung will – und daß diese nicht mehr will, beweisen die Meinungsumfragen und ein Berater des Pentagon. Die Niederlage ist – so der erfolgreiche Kommunistenbekämpfer („Britains successful architect against the Communist terrorists in Malaysia“) Sir Robert Thompson – einem „loss of will“ geschuldet, der jede hochentwickelte Gesellschaft (hoffentlich entwickeln sich die Kommunisten bald) begleitet:
„It's a loss of will. It's something that always happens in a high State of Society. First you get doubt, then you get a feeling of guilt, and finally a loss of will.“ (Newsweek v. 7. 4. 75)
Für „Die Welt“ hingegen ist der Prozeß Zweifel–Schuldgefühl–Willenseinbuße nichts Zwangsläufiges, sondern Resultat von Manipulation: Also sind die schuldig, die Amerikas „Bewußtseinskrise“ und den Stimmungsumschwung gegen Vietnam herbeigeführt haben:
„So muß es denn gesagt werden, daß einen der Ekel würgt, bei einer Pressekampagne, der es nicht genügt, einen alleingelassenen Alliierten seinem Schicksal preiszugeben, sondern ihn auch noch eben jener Täuschung beschuldigt, zu deren Opfer er wurde. Das erbarmungswürdige Schauspiel der Flüchtlinge, die sich an die Tragkörbe der Hubschrauber krallen und in die Tiefe gestoßen werden, wiederholt sich hier im Großformat der amerikanischen Asienpolitik, über die längst nicht mehr vom Weißen Haus, sondern von den Verantwortlichen für die veröffentlichte Meinung der USA entschieden wird.“ (Die Welt zitiert nach der SZ v. 8. 4. 75)
Die eigentlichen Drahtzieher aber sind jene,
„die mit ideologischem Schaum vor dem Mund auf den Straßen antiamerikanische Derwischtänze aufführten. Sie haben das traurige Ende gewollt, das die Welt heute miterlebt; wir anderen haben uns lediglich in die Einsicht geschickt, daß es zu einem erträglichen Preis nicht zu verhindern sei. Das ist ein himmelweiter Unterschied.“ (Sommer)
Die gleiche Ansicht vertritt auch unser Bundesverteidigungsminister mit Zivilcourage – dabei ganz unideologisch(en) Schaum vor dem Mund habend:
„Es gab über Jahre hinweg kaum einen Tag oder kaum eine Veranstaltung bei denen es nicht zum guten Ton gehörte, den Amerikanern Vorwürfe zu machen, weil sie sich in Vietnam engagierten. Sie galten als Verbrecher, weil sie die Flut des Kommunismus von Süd-Vietnam fernzuhalten suchten … klar und nüchtern sehen, daß das, was sich jetzt in Ostasien ereignet, eine zwangsläufige Folge dessen ist, was viele gefordert haben, auch wenn sie nicht gesehen und gewollt haben, was nun mit unerbittlicher Unaufhaltsamkeit bis zum bitteren Ende kommt und kommen wird.“ (Leber in der FAZ „Vietnam und wir“)

3. Journalisten sind die besseren Politiker
Nachdem man sich derart intensiv mit der Erklärung des Scheiterns beschäftigt hat, daß alle Beteiligten zu Schuldigen wurden:
„Ganz Amerika sitzt im Glashaus, wenn es um Vietnam geht.“ (Borch) –
setzt man sich nun mit der Vergangenheit in der Weise auseinander, daß man Pläne für sie zu schmieden beginnt. Dem MSZ-Kollektiv gefielen hier vor allem zwei Vorschläge, die den eigenwilligen Kopf ihrer Erfinder dokumentieren; bedauerlicherweise werden dadurch zugleich zwei neue Schuldige überführt: sie hielten ihre Pläne vor den Verantwortlichen nämlich streng geheim.
Augstein hätte geraten:
„Hätten die USA nur Geld und keine Truppen geschickt, wären dem Volk von Nord- und Südvietnam unendliche Leiden erspart geblieben (was hätten die Südvietnamesen nur mit dem Geld gemacht?). So aber(!) wurde Thieus Niederlage die des großen weißen Vaters in Washington.“
Und auch Thompson verschweigt nicht, was mit seinem Ratschlag verhindert werden sollte:
„the important thing is that Thieu should be given the fuel and the ammunition to do the fighting. I really consider that even if this battle should turn out to be the final one and Thieu should lose it, he must not lose it because the United States betrayed him.“ –
der Gesichtsverlust der Amerikaner, nicht aber die Niederlage ihrer Verbündeten.
4. Was man schlimm finden muß
Nachdem die Journalisten konstruktiv kritisch waren, indem sie zeigten, was man hätte besser machen können, zeigen sie sich nun von ihrer unangenehmsten Seite: sie nörgeln. Weil sie den Krieg nicht erklären und kein begründetes Urteil über ihn fällen können, bekritteln sie als erstes die Art, wie man mit dem „Unausweichlichen“ fertig wird. Amerika spielt seine Rolle schlecht, finden sie, und besorgen sich um den Eindruck, den solches Verhalten auf die Weltöffentlichkeit machen muß.
a. Die Geschmacklosigkeiten des Präsidenten
Nicht der Krieg ist schlimm, sondern die „Manier unglücklich, in der die USA den letzten Akt ihres Krieges spielten!“ (Spiegel) Da macht der Präsident „klägliche Gehversuche in dem Konflikt“ (FR), indem er geschmacklos Babys im Arm hält:
„Warum läßt sich Ford mit vietnamesischen (Kriegs-) Waisenkindern fotografieren? Es wäre geschmackvoller, wenn er die 200 Millionen Amerikaner zu einer »All-Vietnam-Hilfe« auffordern würde.“ (Munzing in der AZ v. 8. 4. 75 „Babyraub oder Babyrettung?") –
versucht er „mit unangebrachten Scherzen Ausflüchte vor den Reporterfragen nach dem Schicksal Südvietnams“ (Stern) und hat als „Antikommunist“ zur Schilderung der Lage Südvietnams nur „zu groß dimensionierte Worte“ (Spiegel) übrig, wenn er sagt:
Da Nang sei eine „ungeheure menschliche Tragödie, die für die gesamte zivilisierte(!) Menschheit tief beunruhigend ist.“
Daß den Präsidenten die Tragödie nur interessiert, insofern sie die Menschheit beunruhigt, ist für den Spiegel nichts Kritikables – sein Herausgeber hatte uns eben schon das gleiche Argumentationsmuster vorgeführt: Leiden des kleinen vietnamesischen Volkes schlimm. Niederlage des großen weißen Vaters schlimmer (vgl. Pkt. 3) –; er findet es dagegen unangebracht, daß „der Präsident im übrigen Golf spielte.“ Hätte er sich vielleicht an die Tragkörbe der Hubschrauber „krallen“ sollen, um dann in die Tiefe gestoßen zu werden? Solche Demonstration des Mitgefühls würde nicht nur Herbert v. Boroh überflüssig erscheinen.
Was einen Journalisten an dem Versuch Amerikas, sich aus der Affäre zu ziehen, schockiert ist nicht der Versuch, sondern daß es nicht klappt, so daß es jeder merkt:
„Hinter markigen Worten kommt nur noch die Hilflosigkeit zum“ Vorschein.“ (Widmann)
Und wer schließlich noch ausspricht, daß Amerika einen Krieg geführt hat –
„You said recently that America's foreign policy is like Napoleon's retreat from Moscow – the route littered with corpses.“ –
wird gebeten, diesen Sachverhalt in passendere Worte zu kleiden: „Isn't that a bit harsh?“ (Newsweek)
b. Gesichtsverlust und Einbuße an Glaubwürdigkeit oder: Don't Rely on the US !
Der „peace with honor", den Kissinger 1973 in Paris aushandelte:
„politisch gesehen wohl das Minimum, das eine Weltmacht fordern konnte“ (Spiegel),
ist heute „vor den Augen der Welt als Täuschung oder Selbsttäuschung enthüllt“ (Spiegel). Wobei wiederum die Enthüllung schlimmer ist als die Täuschung (wir Europäer können uns auf die Amerikaner verlassen):
„Vom Verlust des Gesichts kann man sich auch durch eine humanitäre Aktion nicht freikaufen.“ (SZ v. 27., 28. 3. 75)
Der Gesichtsverlust, der dem amerikanischen Unverständnis des „asiatischen Ehrbegriffs“ (SZ) geschuldet ist, hat gravierende Folgen: die Amerikaner haben als Vertragspartner an „Glaubwürdigkeit“ verloren, so daß – was Höfer bitter findet – es heute „sicherer“ ist „mit den Kommunisten einen Vertrag abzuschließen“ (südvietnamesischer Botschaften). Anlaß zur Sorge gibt neben dieser Schwächung der amerikanischen Position in der Welt die Schwächung im Inneren. Amerika ist da in eine „Krise des Selbstbewußtseins“ geschlittert, so daß nicht nur Werner Höfer verängstigt fragt, wieviel denn noch übriggeblieben ist.
„Amerika hatte für die »Existenz« jenes indochinesischen Teilstaats den Oberstleutnant Calley seine Kriegsverbrechen begehen lassen“
und einen Krieg geführt,
„der außer Amerikas Reichtum auch Amerikas politische Moral schwer schädigte.“ (Spiegel)
Da kann man nur hoffen, daß „das unbefangene, vielleicht naive“ amerikanische „Selbstvertrauen“, das aus Fords Rede sprach, doch noch ansteckend auf den Kongreß wirkt. (Borch)
c. Der Vietkong kostet genüßlich den Sieg aus
Das Schlimmste aber ist,
„Daß sich in dieser Situation niemand (außer dem Bundesverteidigungsminister) vernehmen läßt, der mit der gleichen Qualität und Überzeugung den Kommunisten entgegentritt, wie man den Amerikanern entgegentrat, als sie noch in Vietnam waren.“ (Leber)
Denn Kommunisten werden auch in Zukunft nicht zögern, „der Ausbreitung der Ideologie auch mit Schwert und Feuer den Weg zu bereiten.“ (Leber)
Und da die Kommunistenfeinde heute noch nicht die Qualität der Vietnamgegner haben, versuchen sie es auf ihre Weise: man vergleicht Nordvietnam mit dem Preußen nach dem siebenjährigen Krieg. Als Sieger in diesem dreißigjährigen Krieg
„verdient es Beachtung und Respekt; und der Westen hat einiges an ihm gutzumachen.“ (Haffner)
Man konfrontiert sie mit dem mißratenen Bündnispartner und muß ihnen gezwungenermaßen Mut und Überzeugung bescheinigen:
Sie spielen
„die Trumpfkarte (Thieus Attentäter landet in Nordvietnam) „mit sichtlicher Genüßlichkeit aus“. „Dabei haben die Vietkong-Delegierten, die in Saigon sitzen, persönlich (!) partout nichts zu lachen: Wenn die Hauptstadt direkt von den Nordvietnamesen und Vietkong angegriffen wild, müssen die Vertreter der Befreiungsfront damit rechnen, kaltblütig von den Soldaten Thieus niedergemacht zu werden.“ (Widmann)
Damit ist aber auch die Gefährlichkeit der Kommunisten klargestellt. Das sind schließlich welche, die „die prächtige Gelegenheit zur Infiltration“ nicht ungenutzt verstreichen lassen und auf die der Tod eines südvietnamesischen Generals „eine erfrischende Wirkung ausübt“ (Widmann).
Nachdem man sich so alles Schlimme von der Seele geredet hat, und beim Lamentieren über die Fehler der Amerikaner erneut auf den eigentlichen Feind gestoßen ist, wird nun den Amerikanern versichert, daß man es mit solcher Kritik bewenden läßt:
„Amerika hat in Vietnam geirrt und gesündigt, aber das ist nun vorbei.“ (Haffner)
Sommer erinnert sich, daß die Amerikaner mit all ihren Mängeln doch die eigentlich Trostbedürftigen sind und stärkt sie, indem er ihr Scheitern lobt und Neues fordert:
„Das Richtige gewollt zu haben, auch wenn es nicht darzustellen war, darf kein Anlauf zum Verzagen, zum Rückzug ins isolationistische Schneckenhaus sein."
5. Das weite Herz der Journalisten: Hoffnung und Zuspruch
Nach dieser Absolution der amerikanischen Sünden spricht man mit Ford
„Laßt uns frisch beginnen“
und weiß sogleich, wies weitergehen soll.
Als erstes muß das schlechte Gewissen beruhigt, der Friedensappell des Papstes befolgt und die Bergpredigt Wirklichkeit werden:
„Es gilt kühl und nüchtern für den Tag zu helfen: die Hungernden speisen, die Kranken heilen, die Nackten kleiden, den Heimatlosen ein Obdach schaffen.“ (SZ v. 27/28. 3. 75)
Und wenn man auch die Toten noch lebendig gemacht hat, muß man über die Tagespolitik hinausblicken und sehen, daß Amerika über soviel Menschlichkeit das eigene Interesse nicht vergißt. Mit dem alten Schlendrian wird jetzt Schluß gemacht: Amerika muß „Prioritäten setzen“ und lernen, daß es „schließlich Unterschiede gibt“ zwischen „Kapitulanten", die „nicht auf seine Hilfe zählen dürfen“ und „Verbündeten, die fest und verläßlich sind“, „die sich selbst nicht aufgeben“ (Sommer). Ja, man kann sich freuen, daß Amerika jetzt endlich „gezwungen“ ist, „den Einsatz seiner Mittel am Nutzen für seine Interessen zu messen“ (SZ v. 9. 4. 75): Europa ist schließlich „das direkte Interesse Amerikas“ (Höfer).
Und wer das Interesse Europas bedroht steht ebenso fest wie die Besiegbarkeit des Gegners: Portugal – so schließt Haffner – ist mit Nordvietnam in keiner Hinsicht zu vergleichen …
aus: MSZ 4 – Mai 1975