Parteienlandschaft 79
Nur ganz kleine Sorgen
Nachdem für eine funktionstüchtige Demokratie nicht zuletzt ein lebendiges, für politische Neuerungen offenes, aber auch Kontinuität und Vertrauenswürdigkeit der Politik repräsentierendes Parteiensystem unverzichtbar ist, gilt dem Treiben der vier großen Parteien dieses Landes das ständige aufmerksame Interesse der Öffentlichkeit und insbesondere ihrer Fachleute für Politik. Was sich im Verhältnis von Führung und Basis abspielt, ob dort eher eine geschlossene Linie/Einfallslosigkeit oder politischer Ideenreichtum/Zerstrittenheit herrschen, was die Parteien auf dem Gebiet einer glaubhaften Programmgestaltung leisten, die es erlaubt, den bekanntlich von Natur aus unsteten und politisch noch ungebildeten Wählerwillen auf ein solches Programm zu vereinen und ihm dadurch erst brauchbare – politikfähige – Konturen zu geben, ob die Parteien aber auch genügend Nachwuchskräfte, dringend gefragt sind „Persönlichkeiten“, für das Politiker verschleißende Geschäft der Politik liefern
– all diesen Fragen haben sich die Konservativen, Sozialdemokraten und Liberalen jahraus, jahrein zu stellen und daraufhin begutachten zu lassen, ob sie ihrem demokratischen Auftrag zufriedenstellend nachkommen. Wenngleich das vergangene Jahr in diesem Punkt einige Beunruhigungen mit sich brachte und auch Zweifel an der Tauglichkeit des Parteiengefüges laut wurden, so sieht sich doch die MSZ-Redaktion genötigt, angesichts der 78er Leistungen, auf denen ja auch schon das neue Jahr unermüdlich weiter aufbaut, ihrer Anerkennung Ausdruck zu verleihen: die Einheit aller Demokraten, auch und gerade in der Veranstaltung eines regen Parteilebens sowie die stets wachsame Sorge um ein solches läßt nichts zu wünschen übrig. |
 |
Grüne Einsprengsel
So galt diese Sorge im vergangenen Jahr vor allem auch dem Umstand, daß gewisse Neugründungen in die geordnete Parteienlandschaft einzubrechen beabsichtigten. Zwar bewiesen die Grünen Listen, die ehemalige Umweltbewegung, durchaus demokratische Reife, indem sie von Störaktionen wie der Besetzung von Bauplätzen, also dem Versuch, mißliebige Staatsmaßnahmen einfach zu verhindern, Abstand nahmen. Ihrer hartnäckigen Auffassung treubleibend, der Staat, der durch seine umsichtigen Bemühungen, ein rentables kapitalistisches Produzieren abzusichern, sein Teil zur Zerstörung der Natur beiträgt, zeichne sich durch eine eigentümliche Kurzsichtigkeit und zahllose Unterlassungssünden aus, verließen sie die Wiesen und präsentierten sich in der politischen Szene als wählbare Alternative zur pflichtvergessenen Staatsgewalt. Mit dieser Absichtserklärung, die Erhaltung der Natur nurmehr dann als wichtiges Anliegen zu betrachten und durchsetzen zu wollen, wenn es mehrheitsfähig, also von den Prozeduren demokratischer Herrschaft geheiligt sein würde, erbrachten die Grünen zwar ein respektables Treuebekenntnis zu unserem Staat, was ihnen aber harte Worte seitens der Etablierten nicht ersparte. Wobei die Unruhe in den großen Konkurrenzparteien sich selbstredend nicht der Tatsache verdankt, daß deren Energiepolitik bei einer gewissen Anzahl von Bürgern Unmut und Befürchtungen hervorgerufen hatte – daß Regierende mit Mißstimmungen der Regierten auszukommen verstehen müssen, ist eine Grundregel der Politik. Aber es ging ja schließlich um eine solche Mißstimmung, die sich in Stimmen für die Grünen und gegen die anderen niederzuschlagen drohte und zwar Stimmen, die bei knappen Mehrheitsverhältnissen in den Landtagen durchaus gebraucht werden. Der grün sympathisierende Wähler mußte sich denn einiges anhören, angefangen vom Kommunismusverdacht über den Vorwurf politischer Verantwortungslosigkeit, gegen das Gesamtinteresse an einem gesunden Wachstum ein borniertes Einzelinteresse vertreten zu wollen, bis hin zu der realpolitisch verständlichen Ermahnung, gerade wenn er es ernst meine, müsse er sein Anliegen doch jenen Parteien anvertrauen, die die Macht, die Mittel zu dessen Verwirklichung besäßen.
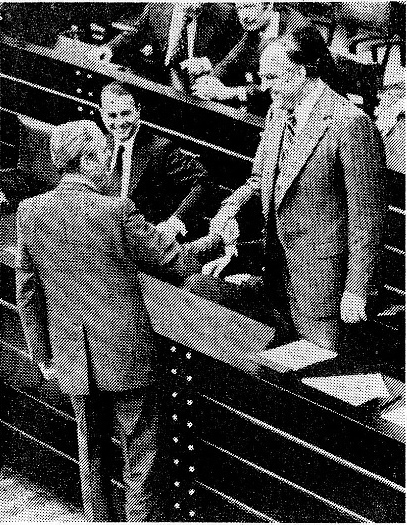 |
Umweltschutz wurde dadurch „von Natur aus Thema der Liberalen“ (Genscher), ebenso natürlich „eine große konservative Aufgabe der Zukunft. Die CDU werde sie anpacken“ (Kohl), die SPD schließlich „die einzige Partei, die die berechtigten Anliegen der Grünen aufnehmen könne“ (Eppler). Solchermaßen erdrückend umarmt obsiegte in den Landtagwahlen die demokratische Vernunft der grün angehauchten Wähler, die bis auf einen vernachlässigenswerten Prozentsatz der Einsicht folgten, daß sich in der Politik nur mit Mehrheiten agieren läßt. Und wenn bei der Bildung der Mehrheiten das Anliegen draufgeht, um dessentwillen man wählen geht, wenn die Stimme bei genau den (mehrheitsfähigen) Parteien landen, die dem eigenen Anliegen die vergangenen Jahre hindurch offen und unübersehbar entgegen gehandelt haben: ohne regierungsfähige Regierung passiert schließlich überhaupt nichts. So bewiesen denn die Resultate der Landtagswahlen mit 1 - 3 % grünen Stimmen eindrucksvoll die Meriten der etablierten Parteien bei der Herstellung eines brauchbaren Wählerwillens. |
Freidemokratisches Mehrheitsgewissen
Zu den Leidtragenden dieses demokratischen Sieges zählt außer den Grünen allerdings die FDP. Die zu den Grünen übergelaufenen Teile ihrer traditionellen Wählerschaft, denen es ihre ökonomische Lage gestattet, sich mehr Sorgen um sozialstaatliche Bevormundungen statt um nicht ausreichende Sozialleistungen zu machen, sich mehr über die Ruinierung der Natur als die der Arbeitskraft zu empören, kosteten der FDP immerhin in Hamburg und Niedersachsen die notwendigen Stimmen zur Überwindung der 5 %-Hürde. Abgesehen davon, daß Umweltschutz die ureigene Aufgabe aller drei großen Parteien ist, ist er seitdem natürlich in der FDP eine besondere ureigene und es sind extra Anstrengungen dafür notwendig, die Glaubwürdigkeit für potentielle grüne Wähler besonders eindrucksvoll zu demonstrieren – ohne Beeinträchtigung der für ein gesundes Wirtschaftswachstum erforderlichen energiepolitischen Maßnahmen und umweltpolitisch notwendigen Rücksichten natürlich. Gebraucht werden daher öffentlichkeitswirksame Bedenken, nicht aber effektive Gegenstimmen in der Energiepolitik – ein etwas heikler Balanceakt, mit dessen überzeugender Inszenierung die Liberalen bis heute alle Hände voll zu tun haben.
Maihofer forderte „programmatisches Profil“. Der Liberalen-Senior Borm rief nach einer „glaubwürdigen Identität“ und der Mainzer Parteitag setzte ein Zeichen: vor weiteren Baugenehmigungen für den Schnellen Brüter in Kalkar müsse weiter beraten und mit der SPD verhandelt werden. Angesichts der Auffassung der Bundestagsfraktionen, daß Weiterbauen und Weiterberaten sich gar nicht ausschließen, war damit die Gelegenheit gekommen, seitens der FDP ein geschärftes Umweltgewissen an den Tag zu legen. Im dreitägigen Ringen zwischen 6 FDPlern, Fraktionsvorsitzenden, FDP-Ministern und Koalitionspartner um einen Kalkar-Kompromiß gaben die Liberalen ihr Bestes. 1. demonstrierten die 6 entschiedenes Gewissen gegenüber aller Koalitionsraison, der sie sich erst mit der Rücktrittsdrohung ihrer Minister im Rücken „beugten“, d.h. nach dem zugunsten der Parteiraison veranstalteten Glaubwürdigkeitsbeweis anschlossen.
 |
Weil das Gewissen Politik verantworten soll, muß es natürlich da auch sein Ende haben, wo diese Möglichkeit der eigenen Partei in vollem Umfang erhalten werden muß, also wird das Gewissen mit der Politik zur Deckung gebracht. 2. sorgten die Minister mit der Rücktrittsdrohung – deshalb so enorm überzeugend, weil sie erhoben wurde, um in der Regierung zu bleiben – für die Glaubwürdigkeit der umweltbewußten Schnellen-Brüter-Gegner, die nur „äußerstem Druck“ wichen. 3. blieb auf diese Weise die Bündnistreue gewahrt, weil die SPD nicht auf die in der Sache einigen CDU-Stimmen zurückzugreifen brauchte. Fazit (Mischnick): „Der gefundene Kompromiß habe es möglich gemacht, die Handlungsfähigkeit der Koalition zu erhalten, ohne daß die sechs auf die Demonstration (sie) ihrer politischen Überzeugungen zu verzichten brauchten.“ Die Schelte der Basis für die „Gewissenserpressung“ der Fraktionsführung und der FDP-Minister auf dem Drei-Königstreffen der Liberalen, bildete den gelungenen Abschluß der Affäre, bei dem sich alle Beteiligten irgendwie wechselseitig versicherten bzw. vorhielten, sie hätten im Grunde genommen recht gehabt bzw. ganz so ginge es auch wieder nicht. |
Interfraktionelle Gewissensprüfung
Daß politische Repräsentanten neben ihrer Parteilinie auch noch über ein Gewissen verfügen, vor dem sie das Grundgesetz höchstpersönlich verantwortlich gemacht hat, daß sie also noch zusätzlich zur Parteizugehörigkeit mit ihrer Individualität für die Legitimation der Politik einstehen können, ist überhaupt eine nützliche Einrichtung, die sich zur Zeit an der kritischen Frage der Verjährungsfrist für NS-Verbrechen bewährt. Vor den Augen einer mißgünstigen Weltöffentlichkeit, die nur allzu gerne dem auf dem Vormarsch begriffenen imperialistischen Konkurrenten Affinitäten zu seinem nationalsozialistischen Vorgänger nachweist, muß der freiheitlichste Staat, den wir je hatten, sich mit dem Auslaufen der Verjährungsfrist wieder einmal der Aufgabe einer demokratisch einwandfreien Nachlaßbewältigung stellen. So sehr aber der Republik um ihren makellosen Ruf zu tun ist als Absicherung ihrer internationalen Geschäfte, die für sich schon Anlaß für Reibereien genug mit sich bringen, ebensosehr widerstrebt es gerade dem dank dieser Geschäfte erstarkten nationalen Selbstbewußtsein, sich immer und immer wieder auf die Stellung zur unschönen deutschen Vergangenheit befragen lassen zu müssen. Die Profis der Politik haben sich daher das Mittel einfallen lassen, auf elegante Weise den Stein des Anstoßes aus dem Weg zu räumen, ohne den Verdacht der Nachsichtigkeit gegenüber NS-Verbrechern zu riskieren. Mit der Aufhebung der Verjährungsfrist für Mord überhaupt ist die Möglichkeit eröffnet, die leidige Frage der Faschismusbewältigung im normalen Geschäft der Rechtssprechung aufgehen und auf ebenso friedliche Weise hinübergehen zu lassen wie die mittlerweile vergreisten NS-Täter, die vor deutschen Gerichten den ebenso vergreisten Zeugen ihre Erinnerungslücken präsentieren, wenn sie nicht gleich der weltlichen Justiz unter den durch Beweisschwierigkeiten und Verzögerungstaktiken aufgetürmten Aktenbergen hinwegsterben.

In Anbetracht der Praxis der Rechtsprechung eine kaum ins Gewicht fallende Revision – in Anbetracht des politischen Effekts jedoch eine saubere Lösung! Daß ein paar gealterte Mörder weniger in den Genuß des „Rechtsfriedens“, der stillschweigenden „Vergebung“ einer kaum mehr nachweisbaren und damit rechtsfähigen Schuld gelangen dürften, ist eine nur geringe Verschiebung der ehernen Gesetze der Gerechtigkeit zugunsten der Politik. Diese entscheidet eben immer noch darüber, was rechtens ist, und verschafft der deutschen Nation damit den gar nicht geringen Vorteil, nicht mehr durch die Demonstration besonderer Unnachsichtigkeit gegenüber ihren vergangenen Untaten die Weltöffentlichkeit um Vergebung bezüglich ihrer jetzigen angehen zu müssen. Und da in diesem Punkt ganz entgegen dem Anschein einer politischen Opportunitätserwägung, der ein paar der Verjährungsfrist verlustig gehende normale Mörder zum Opfer fallen, höchste moralisch skrupulöse Gewissenhaftigkeit zu walten hat, wird die ganze Angelegenheit gleich auch noch durch die Anregung einer interfraktionellen Initiative über alle Parteipolitik hinaus in die Sphäre rein ethischer Gesichtspunkte erhoben. Da das Wählerbewußtsein gespalten ist – z. T. auf säuberlich-demokratischen Antifaschismus Wert legt, zum größeren Teil aber, wie sein Sprachrohr F.J.S. der Auffassung ist, daß wir uns doch heutzutage diese Schnüffelei in unserer Vergangenheit nicht mehr gefallen zu lassen brauchen, entbindet das – diesmal – interfraktionell vorhandene Gewissen die Parteien davon, sich den Unmut einer der beiden Teile zuzuziehen.
Verjährung nicht nötig!
In dieser Angelegenheit Saubermann genug, bewährt sich die Riege der demokratischen Spitzenpolitiker auch andernorts dabei, den Nationalsozialismus als politisches Ärgernis zu Grabe zu tragen. Der Umstand, daß sich bei den Anwärtern auf die Präsidentschaft so gut wie kein ehemaliges Nicht-NSDAP-Mitglied anbietet, läßt hier die Vorwärtsverteidigung geraten erscheinen. Der Kandidat der Christlichen erinnert sich – gemäß der Lehren aus dem Fall Filbinger – genauestens und präsentiert der Öffentlichkeit den Lebenslauf eines jungen strebsamen Staatsdieners, der unter dem Nationalsozialismus dessen Anforderungen an den Führungsnachwuchs nun einmal nicht aus dem Wege gehen konnte. Der junge Carstens – „Vater im 1. Weltkrieg gefallen“, „Mutter lebte von bescheidener Rente“ – dem „ohne staatliche Beihilfen zum Studium“ eine Ausbildung zum Rechtsanwalt versagt geblieben wäre, mußte ja notgedrungen den Aufnahmeantrag in die NSDAP stellen.
| In einer Zeit, in der sich nicht nur Abiturienten, sondern ebenso Haupt- und Realschüler den Drang nach höherer Bildung als verantwortungslosen Egoismus vorhalten lassen müssen, kann ein Bundestagspräsident auf vollstes Verständnis rechnen, wenn er seine frühzeitigen Ambitionen, mit Staat und Recht Karriere zu machen, als pure Existenznotwendigkeit vorführt: stellt doch sein heutiges Amt diese seine Aufstiegsbemühungen zweifelsfrei als uneigennützigen Dienst am Staat dar. Zumal er es klugerweise damals, zu Zeiten des schlechten Staates, vorzog, im nicht so anstößigen Bereich des Privat- statt Völkerrechtlichen tätig werden zu wollen, und sich somit für seine späteren völkerrechtlichen Dienste unbescholten hielt. Sekundiert wird dieser vorbildlichen Verteidigung von höchster Stelle. Der jetzige Präsident startet mit dem zeitlich gut abgepaßten Bekenntnis – „ebenso Mitglied der NSDAP gewesen, weiß aber nicht mehr (!), wie sein Parteieintritt zustande gekommen ist“ – eine taktisch gelungene Offensive zur eigenen Verteidigung wie zur Eroberung der klassischen Entschuldigung für die Funktionäre und Amtsträger des damaligen Staates, man habe eben einfach mitmachen müssen. | 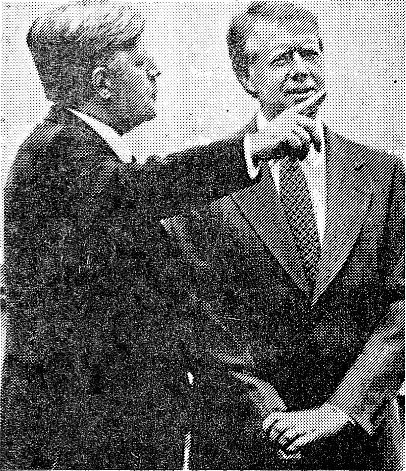 |
Das Bekenntnis zum politischen Opportunismus ist heutzutage ehrenwert und wird geachtet. Was dem Ladendiebstahl nach übereinstimmender öffentlicher Meinung abgesprochen werden muß, die Eigenschaft des Kavalierdelikts, kann die Mitgliedschaft in der NSDAP mit Fug und Recht in Anspruch nehmen. Entweder man hat als Parteimitglied „mitgemacht“, wobei das „gemacht“ natürlich unter den Tisch fällt, „Fast jeder erinnert sich an Ereignisse, an denen er lieber nicht beteiligt gewesen wäre“ (Carstens), – oder man hat sich als Opfer ordentlich hinrichten lassen (wobei kommunistische Opfer heute schon nicht mehr ganz astrein sind). Wer beides nicht aufweisen kann, muß mit mißtrauischen Fragen rechnen, was er dann damals eigentlich getrieben habe.
„Die nominelle Zugehörigkeit zur NSDAP“ gemäß dem Schlußwort des Kanzlers „ist keine Belastung“, ist also nichts, was der Eroberung politischer Ämter im Wege stehen dürfte. Dazu qualifizieren nun einmal politische Tugenden, die sich nicht zuletzt früher schon in pflichtgetreuen Mitmachen bewiesen haben. So wie der junge Carstens als Führungsoffizier der. Truppe den damals vorgeschriebenen politischen Unterricht erteilte, mit demselben Gespür für das, was politisch notwendig, d.h. für den Staat nützlich ist, versah der Kanzleramtschef seinen Dienst inkl. der korrekten Beaufsichtigung der friedlichen Waffenverkäufe des BND, und profiliert sich der Präsidentschaftskandidat mit Reden vor der Hanns-Martin-Schleyer-Stiftung, die mit beispiellosem Mut der antiautoritären Erziehung und dem Bürgerinitiativwesen als Herausforderung an unsere freiheitliche Ordnung den Kampf ansagen.
Der (noch) nicht ersetzbare Verschleißkandidat
Die Union hat also in der Sprache der Presse „keine andere Wahl“, als diesen fähigen Mann zu nominieren. Daß dem nationalsozialistisch unbescholtenen Weizsäcker diese Fähigkeit abgeht, daß der CDU-eigene Friedensapostel und Befürworter der Polen-Aussöhnung (das SPD-Geschäft mit Auswanderern, Renten und Wirtschaftsverträgen) die konservative nationale Identität nicht adäquat zu repräsentieren vermag, wer wird das bezweifeln. In diesem Punkt ist den C-Parteien die schwierige Aufgabe, die geeignete Persönlichkeit zur Verfügung zu stellen, also gelungen (von gewissen Unstimmigkeiten, ob Carstens bezüglich der Waffenverkäufe nun unwahr, bloß ungeschickt, vergeßlich oder aufrichtig geantwortet hat, einmal abgesehen), was ihre Stimmenmehrheit in der Bundesversammlung im übrigen ohnehin bestätigt. Bezüglich des entscheidenderen Amtes jedoch kommt in den Reihen der Union keine rechte Zufriedenheit auf, oder, wie es der CDU-Vorstand ausdrückt, man hat mit einem halben Dutzend einfach zuviel taugliche Kanzlerkandidaten. Der als solcher designierte Kohl läßt also an den erforderlichen Fähigkeiten einiges vermissen.
Neben dem politischen Fehler, daß der unglückselige Kohl meint, die Gründe seines Aufstiegs zum Prinzip seiner Politik machen zu müssen – als Kompromißkandidat, auf den sich die rivalisierenden Flügel der Christlichen geeinigt hatten, hauptsächlich Appelle zur Einheit und Solidarität der Partei loszulassen, um der Geschlossenheit willen die Eskapaden seines Hauptfeindes zu vergeben, anstatt gegen ihn Front zu machen – neben diesem inkarnierten Fehler, die Einheit einer Partei nicht als Mittel zum Zweck, sondern als höchstes Gut zu behandeln, geht Helmut Kohl vor allem eine entscheidende Eigenschaft ab – der Erfolg seines Kollegen Helmut Schmidt. Der Barzelsche Angriff auf Kohl, noch nie habe ein Kanzler so gemütlich regiert wie Schmidt mit Kohl, bescheinigt Kohl treffend als dessen Versagen, daß das klassische Oppositionsinstrumentarium „halbherzig“, „unentschieden“, „konzeptionslos“ angesichts der mit ganzem Herzen, entschieden mit dem Konzept der nationalen Stärke betriebenen SPD-Politik im Wählervolk nicht verfängt. Je mehr die sozialdemokratische Verwaltung der Regierungsgeschäfte unter der tatkräftigen Mitwirkung des nationalen Kapitals demselben zur Blüte und den Regierten zu der Auffassung verhilft, daß „wir“, und das ist nun einmal nicht jeder einzelne von „uns“, gut dastehen, je mehr die diesen Erfolg der Politik repräsentierende Figur sich der Zustimmung der Regierten erfreut umso rapider schwinden auf Seiten Helmut Kohls dessen Führungsqualitäten. Da eine Demokratie vom hartnäckigen Willen ihrer Mitglieder lebt, sich ihr Wohl und Wehe durch den Staat diktieren zu lassen, der die Mehrheit zum fleißigen Dienst am Reichtum anderer und seiner selbst nötigt, pflegen sich die Objekte dieser Politik deren Resultate mit dem Können oder Nicht-Können ihrer politischen Führungspersönlichkeiten zu erklären. So fällt eben für den nicht-regierenden Helmut, da sich das Einverständnis auf den anderen konzentriert, an entsprechend geschätzten Charaktereigenschaften wenig ab. Da die Politik für die Politiker deren Geschäft ist, müssen sie auch das dazugehörige Risiko tragen. Für die Kohl-Partei empfiehlt sich daher ein Austausch mit einer neuen, noch nicht derart mit Erfolglosigkeit verwachsenen Persönlichkeit. Diese wäre allerdings mit der gleichen Kalamität konfrontiert, differierende wahltaktische Linien der Unionsparteien versöhnen und einem Kanzler entgegentreten zu müssen, der anderen Regierungschefs schon gewohnheitsmäßig volkswirtschaftliche und andere Lektionen erteilt. Das macht die Wahl eben schwierig und rettet vielleicht auch noch einmal Kohl als Verschleißkandidaten.

Glück für die Politik – Menschen für die Freiheit – Menschen für die Politik
Angesichts dieser scharfen Konkurrenz, in der die Reformpartei eine kaum mehr mit schönen Aussichten, stattdessen mit unüberhörbar deutlichen Aufforderungen zu Fleiß, Bescheidenheit und Kinderreichtum versehenen Politik den Konservativen in der Gunst der Massen den Rang abläuft, gilt es bei den Christlichen, umso sorgfältiger auf die eigene Linie zu achten. Der peinliche Mißgriff des CDU-Vorstands, der mit seinem Wahl-Slogan für die Europawahl „Politik für die Freiheit, Glück für die Menschen“ auf eine schlappe Werbung mit einem irgendwie gearteten Wohlergehen der Menschen verfallen war, mußte sich völlig zu recht die Kritik der Schwesterpartei gefallen lassen, mit einem solchen „Gänseblümchenslogan“ hinter den mit dem CDU-Parteitag schon erreichten Stand zurückgefallen zu sein. Im Gefolge der fast als hellsichtig zu bezeichnenden Kritik der CSU,
„dieses Motto suggeriere der Bevölkerung, die Politik könnte das individuelle Gut »Glück« garantieren. Durch die Verkürzung laufe die CDU Gefahr, den Menschen mehr zu versprechen, als sie halten könne“
wurde dann dieser gar nicht mehr in die politische Landschaft passende Spruch zurückgezogen. Einer der schärfsten Konkurrenten Kohls hatte bei der Beratung schon das richtige Gespür bewiesen, indem er den von der CSU angeprangerten Fehler, an die Bedürftigkeit der Wähler auch nur zu erinnern, anstatt ihre vorhandene Opferwilligkeit für den Staat unumwunden weiter zu fordern, zumindest durch einen Doppelpunkt gemerzt wissen wollte: „Politik für die Freiheit: Glück für die Menschen“. Der Biedenkopfsche Rettungsversuch hätte die Verkürzung wenigstens durch die angedeutete Klarstellung verbessert, daß Glück nur in Politik für Freiheit, und diese ist bekanntlich zutiefst garantiert durch die Freiheit des Eigentums, die dem Glück der Eigentumslosen nicht immer ganz förderlich ist, weshalb man auch so nicht suggerieren sollte.
Führungsnachwuchs der SPD profiliert sich
Wie auch immer, der Teufel steckt im Detail, und auf Genauigkeit muß jede staatstragende Partei achten, damit ihre Sprüche nicht mißverstanden d.h. nur so mißverstanden werden, wie es opportun ist. Auf dem Gebiet programmatischer Festlegung einer ansprechenden Parteilinie und attraktiver Sprüche kann sich die SPD zur Zeit nichts vorwerfen.
Zunächst einmal hat eine der vielversprechenden Nachwuchskräfte
„schlank und blaß, in einem ihn noch schmaler machenden marineblauen Anzug, mit leiser Stimme und blendender Diktion“
wieder einmal dafür gesorgt, daß die SPD ins Gerede kam. Der Hamburger Bürgermeister und der prompt an ihm entdeckte „jungenhafte Charme“ kann die öffentlichkeitswirksame Anregung zur Überprüfung des Extremistenerlasses auf sein Konto verbuchen. Die Demonstration, daß es immer noch die SPD ist, die ein Herz für junge Menschen mit ihren manchmal leicht abwegigen Gedanken hat, weshalb man nicht gleich so zuschlagen sollte, daß sie ganz unbrauchbar werden, diese Demonstration ist gelungen, der sachliche Kern inzwischen auch anerkannt. Die Umständlichkeit des bisherigen Verfahrens, alle Bewerber für ein öffentliches Amt überprüfen zu lassen, läßt sich doch entscheidend dadurch vereinfachen, daß eine Anfrage nur dann stattfindet, wenn „der Behörde Tatsachen bekannt sind“, also eine einfache aber rationelle Umdrehung des Verfahrens stattfindet: statt Anfrage Meldung „bekannter Tatsachen“ durch den Verfassungsschutz bei den zuständigen Behörden.
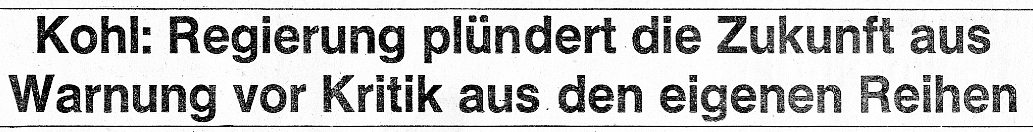
Auch der zweite Klose-Auftritt, die hübsche Koketterie mit der Vokabel Stamokap, hat den gewünschten Effekt gehabt: die Demonstration, daß es immer noch die SPD ist, in der vorurteilslos ketzerische Gedanken geäußert und frei diskutiert werden können, ebenso öffentlichkeitswirksam begleitet durch die beschwichtigende Rügen der SPD-Oberen, die der rechten Wählerschaft wiederum glaubhaft versicherten, daß sich mit Kommunismus in der SPD nichts tut. Und auch hier wieder ist der sachliche Gehalt der Klose-Sprüche durchaus etwas staatlicherseits Bedenkenswertes: die hamburgische Anregung, das Instrumentarium der staatlichen Wirtschaftsförderung daraufhin zu überprüfen, ob es nicht effektiver zum Einsatz gebracht werden kann, ob nicht manche Subventionsgelder einfach in private Kassen abfließen anstatt produktiv und d.h. für die Förderer steuerwirksam angelegt zu werden, diese Anregung wird sicher Gehör finden, zumal die Konjunkturlandschaft, in der insgesamt das Kapital auf sehr kräftigen eigenen Füßen steht, gewisse Formen staatlicher Unterstützung sicher entbehren kann. Und daß gerade ein Hamburger Wirtschaftspolitiker auf den Gedanken kommen muß, seine auf Dauer subventionierten Werften dazu aufzufordern, sich doch um neue Produktionsbereiche und zukunftsträchtigere Aufträge zu kümmern, und sich dazu aufmacht, solche höchstpersönlich in Ägypten und anderswo aufzusammeln, dürfte endgültig jeden Zweifel an der politischen Qualifikation dieser Figur ausräumen. Wie Willy Brandt überhaupt treffend bemerkte, die SPD hat keinen Führungsnachwuchsmangel; neben Klose, dessen absolute Mehrheit ihm die Fähigkeiten hat wachsen lassen, dank derer ihn nun seine Partei als Mann mit Denkanstößen begrüßt, profitieren noch etliche Mittvierziger mit ebenso jungenhaftem Charme und bestechender Diktion vom Erfolgskurs der Sozialdemokratie.
Die Jusos der 80er Jahre stellt der Parteivorstand
Auch die Mutterpartei hat es zur Zeit recht einfach. Um ihrer Glaubwürdigkeit als Reformpartei willen muß sie sich nicht einmal mehr sozialstaatliche Gesetzesinitiativen von gefälligem Aussehen einfallen lassen. Den Orientierungsrahmen hat man ja nach wie vor zum Orientieren, und daß die Politik mit Augenmaß gemacht werden muß, um den nun schon bald im 3. Jahr gefährdeten Aufschwung, der sich schon längst zu einem flotten Boom ausgewachsen hat, nicht zu gefährden, leuchtet noch jedem ein. Um den Nimbus der Reformer zu erhalten, genügen deshalb völlig ein paar gewerkschaftsfreundliche Parolen, die der SPD-Parteitag im Europa-Programm niedergeschrieben hat. 35-Stunden-Woche, ein Verbot der Aussperrung und demokratische Kontrolle der Multis sind wohlfeile europapolitische Ziele – verabschiedet unter Assistenz einiger DGB-Chefs mit dem demokratischen Verzicht darauf, die eigene Bundestagsfraktion auf entsprechende Gesetzesinitiativen festzulegen. Das könne man dem Koalitionspartner leider nicht zumuten. So nützlich ist die Partnerschaft: sie läßt sich jeweils als Hindernis für dasjenige ins Feld führen, was man selbst genausowenig in Angriff nehmen will. Im übrigen ist Europa nicht die BRD, „der Weg zu einem sozialen Europa ist lang“, und bis dahin sind „noch viele Schritte zu tun“ (Wehner), weshalb man im eigenen Land logischerweise keine tun kann, nicht ohne aber durch diese Sprüche sich den etwas radikaleren sozialdemokratischen Schwesterparteien Europas verbunden und im eigenen Land sich gewerkschaftsfreundlich zu zeigen. Während frühere Programmdiskussionsinszenierungen noch kräftig die Ideale beschwören und nur gegen Ende mit dem Hinweis auf das Machbare den politischen Realismus einführen mußten, genügt heutigentags die bloße Nennung schöner Ziele und daß sie nicht gehen, sagt man gleich dazu. Dieses gegenüber früheren SPD-Parteitagen perfektionierte Verfahren – als Reformer hat man Ideale, um sie heraushängen zu lassen –- kostet natürlich auch ab und an einige Austritte wie die der 27 enttäuschten Bremer, die nach jahrelangem treuen Dabeisein sich zu der immer noch SPD-treuen Feststellung durchringen mußten, ihre Partei leide an einer „Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit“. Daß sich die Partei deswegen keine grauen Haare wachsen lassen muß, bescheinigt ihr die eigene Unterorganisation zur Einfangung kritischer Jugendlicher. Dort rührt sich wenig, so daß die Zurschaustellung einer radikalen, aber SPD-konstruktiven Linie sich fast gänzlich erübrigt. Was diesbezüglich nötig ist, läßt sich durch Veranstaltungen wie die Klose-Auftritte oder Bahrsche Bemerkungen zur Neutronenbombe, also von den Parteispitzen nebenher noch miterledigen.
Die Schlagkraft der Nation
Die Parteien vernachlässigen also keineswegs ihre demokratischen Pflichten. Gerade weil sie sich in der Sache so einig sind, einiger denn je zuvor – wie die Sozialliberalen die Belange des Kapitals im In- und Ausland durchgesetzt, seine Sanierung direkt unterstützt und durch sozialstaatliche Rationalisierungen abgesichert, die Hochschulen befriedet und mit der Terrorismuskampagne die letzten Reste widerspenstigen Denkens auf Linie gebracht haben, daran kann beim besten Willen kein Konservativer etwas auszusetzen finden –, weil also die Opposition sich in die undankbare Rolle gedrängt sieht, ihre alternativen Forderungen auf ein „Das-gleiche-nur-besser-als-die-SPD“ zurücknehmen zu müssen, gerade deshalb ist die Pflege des unterschiedlichen Bildes der Parteien so besonders wichtig und der Kampf um prägnante Parolen und ansprechende Gesichter von enormer Bedeutung. Ein Strauß verzweifelt langsam an der Welt, die seine Träume von einem potenten deutschen Staat durch einen SPDler ausführen läßt und ihm den erbärmlichen Schacher aufnötigt, mit dem Nebeneinander zweier rivalisierenden Linien, um liberale SPD-nahe Stimmen werben gehen zu müssen und gleichzeitig die rechte Stammwählerschaft, die sich auch nicht vermehrt, bei der Stange zu halten (ein Dilemma, das auch die durch eine 4. Partei vollzogene organisatorische Trennung nicht beseitigt, da die 2 Parteien mit ihrem vorgezogenen Programm der gemeinsamen Regierungsbildung das überzeugende alternative Element vermissen lassen).
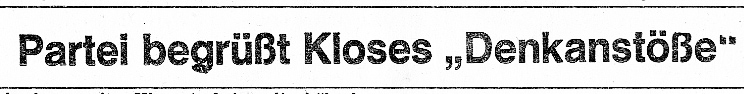
Bei aller Regsamkeit ist das Parteienleben also ziemlich eintönig, es funktioniert zu gut, und das ist auch der Grund, weshalb der Kanzler in seiner Silvesteransprache, mitten in einer Zeit moralischer und sonstiger Aufrüstung der Nation, derselben auf ihren Bildschirmen versicherte, daß „Nationalismus bei uns nicht gefragt“ sei. Angesichts eines auf der ganzen Linie erfolgreichen Nationalismus würde sich eben jeder blamieren, der mit einem besonderen Programm „Deutschland über alles“ auftreten wollte. Parteigründungen auf dem rechten Flügel verschwinden denn auch regelmäßig mit der Gründungsmeldung wieder in der Versenkung. Worin könnte denn auch ein von Thadden erfolgreicher agieren als der jetzige führende Mann? Und zu dessen Regierungstätigkeit, unter der der deutsche Staat dank seiner Wirtschaftsfront sich endgültig den internationalen Führungsanspruch erobert, paßt nun einmal besser der Nationalismus, der sich dadurch herausstreicht, daß er von sich keine großen Worte macht, eben, weil er Geltung besitzt im In- und Ausland, der sich bei all seinen ökonomischen und politischen Eroberungen das Ideal des Internationalismus, des europäischen Teamgeistes oder der allgemein westlichen Partnerschaft zulegt. Deshalb konnte der Kanzler zu Silvester auch auf alle mahnenden Worte und Zurechtweisungen verzichten und stattdessen Zufriedenheit mit dem Stand der Politik und der Nation an den Tag legen, mit Ausnahme natürlich der „lauwarmen Demokraten, die wir nicht brauchen können“, von denen es ja aber auch kaum mehr welche gibt. Diese Gewißheit im Rücken hinterließ der Kanzler seinem Volk die Ansprache und genoß seine Weihnachtsferien auf Guadeloupe. Im intimen Kreis, hemdsärmelig im Freizeitlook, zwischen Frühstück und Ausflug die Weltgeschäfte ordnen – so zivil und mediengerecht gibt sich heutzutage der Imperialismus, als hätten die täglich laut gezählten Leichen in aller Welt mit diesen netten Männern nicht das Geringste zu schaffen.

Die Potenz des Imperialismus aber ist mittlerweile einem Herrn Schmidt in Fleisch und Blut übergegangen, bei dem das Schmatzen zwischen den Sätzen kein Schmatzen mehr ist, weil die Macht ihm Bedeutung verleiht. Eine herablassende Arroganz dieses Kalibers kann sich kein gewöhnlicher Bürger leisten, und sei er noch so vermögend. Im Gehabe von Helmut Schmidt ist die Schlagkraft einer Nation personifiziert – seine Frechheiten leben von der Sicherheit des Erpressers, der seine Opfer ironisch als Partner glossiert, ob das Thema nun Nord-Süd-Dialog, Europa, Nato oder Ostpolitik heißt. Kein Wunder, daß mancher Deutsche bei einem solchen Führer und einer solchen Nation auf den Gedanken kommt, daß sich doch bei Gelegenheit etliches politisches Personal ersparen und die Regeln des Regierens vereinfachen lassen müßten.
aus: MSZ 27 – Januar 1979