Die demokratisch-orientierte Gewerkschaft:
Was feiert der DGB am 1. Mai?
Am Feiertag der Arbeit wird nicht gearbeitet, sondern das gefeiert, was man den Rest des Jahres machen muß: arbeiten für Geld, Lohnarbeit. Die organisierte Interessenvertretung der Arbeiter, die Gewerkschaft, nimmt den Feiertag zum Anlaß, auf errungene Erfolge bei ihrer Tätigkeit hinzuweisen und neue Forderungen im Namen ihrer Mitglieder anzumelden. Was Maikundgebungen in der BRD und Westberlin auszeichnet und was einen ersten Hinweis auf die Besonderheit der hiesigen Gewerkschaftsbewegung gibt, ist das Auftreten von Staatsmännern, die dem Ereignis den feierlichen Anstrich erst so richtig verleihen. Zum anderen erklärt dies, warum der 1. Mai im Gegensatz zu seinen Anfängen nicht nur ein Staatsfeiertag ist, sondern sich auch der wohlwollenden Duldung durch die Unternehmer gewiß sein kann, die an diesem Tag wenn irgendmöglich nicht arbeiten lassen dürfen, wozu sie sich in Manteltarifverträgen verpflichtet haben. Sie können sich auf den Maikundgebungen ausreichend durch die Staatsmänner repräsentiert fühlen, denen doch in der Demokratie ihr Wohl ebenso am Herzen liegen muß wie dasjenige der Maifeierer, sind sie doch der ganzen Gesellschaft verpflichtet, also nicht nur der Lohnarbeit, sondern auch dem Kapital.
Gerade am 1. Mai 1976 wird staatsmännischer Überzeugungskraft einiges abverlangt: wo der Aufschwung immer noch sich auf die Auftragsbücher der Unternehmer beschränkt und auf den Kundgebungsplätzen auch solche Arbeiter die Arbeit feiern, die zur Zeit keine haben, mag es dem naiven Beobachter als unlösbare Aufgabe erscheinen, die Vertretung der Arbeiterinteressen mit dem Handeln des Politikers zu harmonisieren, das in der Krise vor allem darin besteht, das Unternehmerinteresse zu befördern, damit es wieder investiert. Bei diesem Geschäft, die Kapitalakkumulation wieder gewinnträchtig zu gestalten, wird es ohne Verzicht derer, die sie zu erarbeiten haben, nicht abgehen. Von diesen verlangt dies eine Gesinnung, die nicht nur an der Lohntüte sich orientiert, sondern die das Wohl der ganzen Wirtschaft – und das fällt halt mal in der Krise besonders augenfällig mit dem des Kapitals zusammen – im Auge behält. Daß der DGB sich zum 1. Mai den Helmut Schmidt, den Willy Brandt und auch den Hans Katzer holt, zeigt, daß er über eine solche Gesinnung verfügt und sie auch noch öffentlich zur Schau stellen möchte. Woraus er diese bezieht und wie sie sich im Handeln und in der Ideologie der westdeutschen Gewerkschaften zeigt, soll an zentralen Punkten gewerkschaftlicher Politik untersucht werden.
Alle Zitate, soweit nicht anders vermerkt, aus: Leminsky/Otto (Hsg.), Politik und Programmatik des DGB, Köln 1974 (I); DGB-Bundesvorstand (Hsg.), Angenommene Anträge und Entschließungen des 10. ord. Bundeskongresses vom 25. bis 30. Mai 1975 in Hamburg. Düsseldorf, 1975 (II) Zur Theorie und Praxis westdeutscher Gewerkschaften vgl. auch: MSZ Nr. 5/1975 („Lehren aus der Krise bei VW“); MSZ Nr. 4/1975 („Wenn Lehrer Perspektive haben – Gewerkschaftspolitik im Ausbildungsbereich“) |
Tarifpolitik: Das Ringen um ein einen konjunkturgerechten Abschluß
Alle Jahre wieder laufen die Tarifverträge aus, und das Tauziehen zwischen den DGB-Gewerkschaften und den Arbeitgeberverbänden füllt die Massenmedien. Dieses Jahr gestaltet sich der Handel besonders schwierig, denn:
,,Die bevorstehenden Tarifverhandlungen sind vor dem Hintergrund einer tiefgreifenden Wirtschaftsrezession zu führen.“ (Die Quelle, Funktionärszeitschrift des DGB, 26. Jg., Nov. 75, S. 497)
Der DGB macht sich dazu selbst Auflagen:
„Gewerkschaftliche Tarifpolitik wird sich in diesem Jahr an der Unsicherheit der wirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere bei der internationalen Preisentwicklung, dem Auftragseingang, den Investitionen und der Mengenentwicklung richten müssen.“ (a. a. O.498)
Tarifrunde in schwerer Zeit
Auf diesem Hintergrund fordert z. B. die IG-Druck im März '76 Lohnerhöhungen von neun Prozent, eine Steigerung also, die real keine ist, da die Inflation alles wegfrißt. Trotzdem herrscht helle Empörung über diese „maßlose Forderung“ auf Seiten des Bundesverbandes Druck:
„Solche Lohn- und Personalkostenerhöhungen kann keine Druckerei verkraften“ (Handelsblatt 24.3.1976)
Nach diesem Vorspiel beginnen die Tarifverhandlungen am grünen Tisch. Beide Seiten rücken mit qualitativ gleichen Argumenten an: wirtschaftliche Lage, weiterer Konjunkturverlauf, Arbeitslose...Die Gewerkschaft versucht auf dieser Basis nachzuweisen, daß neun Prozent exakt der Konjunktur entsprechen, keinesfalls überzogen sind. Dieselbe Konjunktur ist für die Gegenseite der Grund, quantitativ ganz andere Schlüsse zu ziehen: sie wartet mit Fakten auf.
„Die Druckindustrie hatte 1975 den schärfsten Konjunktureinbruch seit Kriegsende. Sie erzielte einen Umsatz von rund 13,4 Mrd. DM, was nur nominal 2,9 Prozent mehr sind als im Vorjahr. Real, das heißt unter Berücksichtigung kostenbedingter Preissteigerungen von 10,9 Prozent, schrumpfte der Umsatz um 7,2 Prozent“ (HB 24.3. 1976)
Mit was sollen die neun Prozent bezahlt werden, jammern die Unternehmer, „Mehr als 4,5 Prozent sind nicht drin!“ Warum ausgerechnet 4,5 Prozent bezahlt werden können und nicht noch weniger, was der Umsatz vom 1975 im Vergleich zu dem von 1974 mit den Lohnforderungen von 1976 direkt zu tun haben soll, ist zwar nicht erklärt, aber immerhin liegt ein Angebot vor, an dem die Gewerkschaft sich abarbeiten kann. Da unsere Gewerkschaften es sich nicht so einfach machen wie ihre Kollegen in Frankreich und Italien zum Beispiel, die ihre Forderungen einfach mit den beschissenen Lebensverhältnissen ihrer Arbeiter begründen, tun sie sich schwer. Mit den sich selbst gemachten Auflagen lassen sich die Argumente der Gegenseite nicht ohne weiteres vom Tisch wischen, und da beide Seiten sich nicht nachweisen können, ob 4,5 oder 9 Prozent konjunkturgerecht sind, einigt man sich nach zähem Ringen irgendwo dazwischen. Mit Streik drohen die Gewerkschaften heutzutage nur, um den Gegner kompromißbereit zu machen, nicht um die geforderten 9 Prozent durchzusetzen. Man läßt ein bis zwei Prozent nach, erwartet dasselbe vom Gegner und einigt sich schließlich knapp unter der Mitte. Diese X Prozent, eine Steigerung, die real eine Lohnkürzung bedeutet, werden nachher von beiden Seiten als „konjunkturgerechter Abschluß“ gefeiert. Das Fernsehen strahlt rührende Szenen aus, in denen sich die Widersacher die Hände schütteln – breitgrinsend. Mit dem gleichen Argument – Konjunktur – haben also die Unternehmer ihr Ziel, möglichst wenig zu zahlen, erreicht und die Arbeiter haben zwar real weniger Lohn als vorher, dürfen sich aber des Danks der Nation gewiß sein. ÖTV-Chef Kluncker faßt solche Ergebnisse treffend zusammen: „Die Tarifbewegung hat eine ungewöhnliche Antwort auf eine ungewöhnliche Situation zu geben.“ Die ungewöhnliche Situation erfahren die in den Gewerkschaften zusammengeschlossenen Arbeiter und Angestellten seit Monaten am eigenen Leib. Die Antwort des DGB ist so ungewöhnlich nicht, ist doch die Konjunktur schon länger das erste Argument und nur das zweite die unmittelbaren Interessen seiner Mitglieder.
Für diese Haltung gibt es sogar Lob vom Gegner. Das „Handelsblatt“ schreibt zu den Tarifabschlüssen der Metallindustrie in Nordwürttemberg/ Baden: „Die Zustimmung der Metallgewerkschaft zu diesem gemäßigten Tarifabschluß bedeutet die einkommenspolitische Weichenstellung in Richtung gesamtwirtschaftliche Expansion, die letztlich auch der Gesamtheit der Arbeitnehmer zugute kommen wird. Mit diesem bewußten Schritt gegen kurzsichtige Mitgliederinteressen an einer Expansion des Realeinkommens...“ (HB, 15.3.1976) Den Arbeitern wird also empfohlen, jetzt zu verzichten und einen Wechsel auf die Zukunft zu ziehen — und dies nicht nur von seiten des Kapitals. Aber ist der Wechsel einlösbar? |
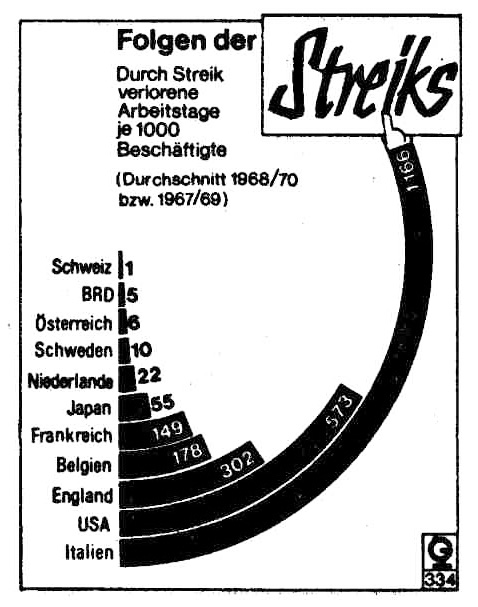 |
Die wirtschaftliche Lage
In jeder Phase der Konjunktur sind die Löhne nichts anderes als Kosten für die Unternehmer. „Gemäßigte Tarifabschlüsse“, das ist immer die Devise des Kapitals — auch in der Hochkonjunktur. Der „Gesamtheit der Arbeitnehmer“ kommt im Boom also nicht deshalb mehr zugute, weil sie sich in der Krise mäßigten, sondern weil die Unternehmer in solchen Zeiten möglichst viel Arbeit brauchen, um die überdurchschnittlichen Gewinne einzufahren. Die „gesamtwirtschaftliche Expansion“ erfolgt eben nicht im Interesse der Arbeiter; daß dabei die Nachfrage nach Arbeit steigt, ist nur eine Wirkung und nur deshalb zahlen die Unternehmer höhere Löhne — wenn sie durchgesetzt werden. Und wenn sie durchgesetzt werden, dann heißt es in zwei Jahren im „Handelsblatt“ mit Sicherheit: „Die Gewerkschaften provozieren die nächste Krise mit den überhöhten Tarifabschlüssen.“ Der Wechsel auf die Zukunft ist also keiner (Ausführliches dazu vgl. MSZ Nr. 8/75 „Die Krise“).
Die beständige Lohndrückerei der Unternehmer mit dem Argument der prekären wirtschaftlichen Lage ist nichts Ungewöhnliches. Auch in der sozialen Marktwirtschaft geht es darum, möglichst billig zu produzieren, um konkurrenzfähig zu sein. Daß der DGB mit demselben Argument seinen Mitgliedern das Maßhalten abverlangt, ist für eine Interessenkoalition ungewöhnlich, aber der DGB praktiziert es. Wenn sein erstes Argument in Tarifverhandlungen die Konjunktur ist, die sicher nicht von den Arbeitern gemacht wird, dann können die Interessen der Arbeiter nur unter Berücksichtigung der Interessen der Unternehmer verfolgt werden.
Tarifpolitik heißt somit für den DGB, seine ganze Macht einzusetzen, einen konjunkturgerechten Abschluß für die Arbeiter zu erzielen. Die wirtschaftliche Lage ist für die Tarifpolitik freiwillige Beschränkung und Ausgangspunkt der Forderungen; Lohnerhöhungen werden an die Ertragslage gekoppelt, von dieser abhängig gemacht. Im Interesse einer florierenden Wirtschaft fordert der DGB seine Mitglieder auf zurückzustecken, nimmt den Unternehmern Sorgen ab und fördert damit eine florierende Kapitalverwertung. Und diese Politik gilt nicht nur für die Krise, sondern ist vom DGB in vier Grundsätzen festgehalten.
Wirtschaftspolitik! Dabeisein ist alles!
Wenn der DGB in Tarifverhandlungen seine Mitglieder agitiert, sich zum Nutzen aller einzuschränken, dann geht es nicht an, daß der Staatsapparat ohne die Beteiligung des DGB Wirtschaftspolitik betreibt. Wie in den Grundsätzen zur Tarifpolitik deutlich wurde, geht es unseren Gewerkschaften darum, Stabilität und Lohnverbesserungen unter einen Hut zu bringen. Dieser Hut wird in den „Grundsätzen zur Wirtschaftspolitik“ (48 ff.) dem Wirtschaftsminister zum Aufsetzen gereicht.
Gewinnstreben gemäßigt
Zunächst macht der DGB-Vorstand Vorschriften, was das Wirtschaften zu sein hat:
„Die Wirtschaft hat der freien und selbstverantwortlichen Entfaltung der Persönlichkeit innerhalb der menschlichen Gemeinschaft zu dienen. Wie jedes Glied der Gemeinschaft muß auch der Arbeitnehmer sein Leben in freier Selbstbestimmung gestalten können. Jedes Wirtschaften ist seiner Natur nach gesellschaftlich. Es darf nicht allein vom Gewinnstreben bestimmt sein. Von wirtschaftlichen Entscheidungen werden insbesondere die Arbeitnehmer betroffen. Deshalb müssen sie und ihre Gewerkschaften gleichberechtigt an der Gestaltung der Wirtschaft beteiligt werden.“ (I/48)
Schöner läßt sich die Ideologie des DGB kaum zusammenfassen: Im ersten Satz wird das Ideal verkündet, das man braucht, weil die Realität anders ist, die Wirtschaft gerade nicht der „Entfaltung der Persönlichkeit dient“. Das muß auch der DGB anerkennen, sonst brauchte er im zweiten Satz nicht die „freie Selbstbestimmung der Arbeitnehmer“ zu fordern. Bisher haben diese wohl was anderes zu tun, was das Wort „Arbeitnehmer“ schon andeutet. Das ganz andere taucht beim DGB als „Gewinnstreben“ auf, gegen das er im Prinzip nichts hat, nur wenn es bei den „Arbeitgebern“ im Übermaß auftritt. Die Arbeitnehmer sind bisher diesem Streben unterworfen, da Gewinn aber Resultat des „gesellschaftlichen Wirtschaftens“ ist, darf – so der logische Schluß des DGB – dieses Streben nicht alles bestimmen. Auf die Unterworfenen muß Rücksicht genommen werden, da diese ein wesentlicher Teil des „gesellschaftlichen Wirtschaftens“ sind. Das Gewinnemachen soll nicht etwa abgeschafft werden, nein, die Betroffenen sollen „gleichberechtigt an der Gestaltung der Wirtschaft beteiligt werden.“ Die Beteiligung der Betroffenen soll also dazu dienen, Gewinnstreben und Selbstverwirklichung unter einen Hut zu bringen. Demokratie macht's möglich!
Arbeit macht das Kapital gewinnbringend
Wie die dazu passende Politik aussieht, die der DGB dem Staat vorschlägt, ist in „Ziele und Mittel der Wirtschaftspolitik“ (I/48f) festgelegt:
„Eines der Grundrechte des Menschen ist das Recht auf Arbeit. Es kann nur durch Vollbeschäftigung verwirklicht werden.“ (ebd.)
Der DGB fordert dafür ein „optimales Wirtschaftswachstum“ und muß sich dann von Seiten der Kapitalisten sagen lassen, daß all dies von den Gewinnerwartungen abhängt. Natürlich haben die Unternehmer nichts gegen das Grundrecht auf Arbeit, wieso auch, Arbeit ist ja nötig, um Gewinne zu machen. Aber gibt's keine Gewinne, gibt's auch keine Arbeit. Das Recht auf Arbeit ist also der Zwang zur Arbeit für den Gewinn des Kapitals! Die Gewerkschaften wissen um diesen Zusammenhang – „Privatwirtschaftliche Rentabilität heißt das Gesetz des Fortschritts. Wachstum wird gemessen an privaten Kosten und Erträgen.“ (1/67) – leugnen ihn aber zugleich und verlangen von der staatlichen Wirtschaftspolitik, den Gegensatz von Kosten (Arbeit) und Erträgen harmonisch zu gestatten. Die nötigen Daten stellt er dem Staat mit seinen sozialökonomischen Analysen zur Verfügung – und wird von diesem prompt beschimpft: Im Sinne der Arbeiter schön gefärbte Analysen, die zu einer „wirtschaftlich verantwortungslosen Interessenspolitik“ (1/190) führen. Der DGB wehrt sich, verweist auf seine Tarifpolitik, auf die maßvollen Abschlüsse usw. und verlangt zugleich, daß nicht alles auf dem Rücken der Arbeiter ausgetragen werden dürfe. Weil der DGB nun festgestellt hat, daß das Recht der Arbeit nicht das der Freiheit ist, fügt er dem Recht auf Arbeit noch ein „Recht auf Selbstverwirklichung“ hinzu. Das Interesse an einer starken Wirtschaft schöpferisch mit Kampf gegen das „unmenschliche Gewinnstreben“ zu verbinden, das wäre nun geschafft! Vom Gegner, den der DGB zum Partner machen will, muß er sich jedoch sagen lassen, daß dieser andere Interessen verfolgt und sie auch durchzusetzen gedenkt. Die frommen Wünsche des DGB können die Herren Unternehmer nicht berücksichtigen, wollen sie in der Konkurrenz bestehen. Und da der DGB ein Interesse am festen Stand der deutschen Wirtschaft hat, was er mit dem Staat und dem Kapital teilt, stimmt er praktisch – wie sich in der Krise gezeigt hat – einer Wirtschaftspolitik zu, die allein vom Gewinnstreben bestimmt ist. Die Ideale wird man dafür am 1. Mai los!
Der Versuch des DGB, den Widerspruch von Lohnarbeit und Kapital in Harmonie aufzulösen, der immer wieder daran scheitert, daß es dem Gegner um diese Harmonie gar nicht geht, bestimmt auch die weiteren Vorschläge des DGB zur Wirtschaftspolitik.
 |
| Tarifpartner Schleyer, Loderer: Auf dem Wege zum konjunkturgerechten Abschluß |
Technischer Fortschritt ohne soziale Härten
So fordert der DGB: die Wirtschaftspolitik muß „auf die volle Entfaltung und Nutzung aller produktiven Kräfte gerichtet sein.“ (1/43) Und dagegen hat auch keiner was, solange die Gewinne stimmen. Das Problem, daß bei einer Nutzung aller Produktivkräfte gewisse Nachteile für die arbeitenden Menschen nicht zu vermeiden sind, löst die Gewerkschaft durch einen moralischen Zusatz:
,,Der technische Fortschritt muß jedoch dem Gesamtwohl dienen. Er darf nicht zu sozialen Härten für die Arbeitnehmer führen.“ (1/48)
Wenn, wie im letzten Jahr, die Unternehmer wieder einmal zeigen, wie scheißegal ihnen dieses Gejammer ist, gibt dies nur einen Grund her, weitere Verbesserungen zu fordern. So schlägt der DGB einen „volkswirtschaftlichen Rahmenplan“ vor, denn ,,die wirtschaftliche Entwicklung darf nicht sich selbst überlassen bleiben.“ (1/50)
Investitionslenkung gegen Fehlleitung
Von da ist es natürlich nicht weit zur Investitionslenkung und tatsächlich steht auf der nächsten Seite des Grundsatzprogramms zu lesen:
„Fehlleitungen von Kapital und Arbeit sind ebenso wie Arbeitslosigkeit und Nichtausschöpfung der wirtschaftlichen Wachstumsmöglichkeiten eine Belastung des Lebensstandards. Deshalb müssen im privatwirtschaftlichen wie im öffentlichen Bereich die Investitionen und strukturellen Erfordernisse der Gesamtwirtschaft abgestimmt sein.“ (1/51)
Freilich, „ohne die letzte Entscheidung über Art und Umfang der Investitionen aus dem Bereich des einzelnen Unternehmens herauszunehmen.“ (1/51, Näheres zur Investitionslenkung vgl. MSZ Nr. 7/75)
Wären die Fehlleitungen so erfolgreich beseitigt und würde eigentlich alles passen, gibt's da immer noch die Multis. Obwohl der DGB gesagt hat – „Es darf nicht alles vom Gewinnstreben bestimmt sein“ – halten die sich einfach nicht daran und machen munter Gewinne. Was liegt näher, als die „Kontrolle wirtschaftlicher Macht“ zu fordern. „Entscheidend ist, daß der Mißbrauch wirtschaftlicher Macht verhindert und eine soziale Gestaltung (!) der Wirtschaft gesichert wird.“ (1/51) Natürlich leistet so auch der DGB das Versprechen, seine Macht nicht zu mißbrauchen.
Jedem Arbeitsmann sein kleines Vermögen!
Neben diesen tagespolitischen Sorgen hat der DGB nun auch noch langfristige Perspektiven anzubieten. Die Feststellung zum Beispiel, daß „die gegenwärtige Einkommens- und Vermögensverteilung ungerecht ist“, (1/49) löst beim DGB immer wieder Empörung aus und treibt ihn zu neuen Forderungen: „Es ist dringend erforderlich, alle Volksschichten an der volkswirtschaftlichen Vermögensbildung zu beteiligen.“ (1/49) Jedem Arbeitsmann sein kleines Vermögen! Wenn das nicht dem Interesse der Arbeitnehmer entspricht, was dann? Aber wie soll diese Forderung realisiert werden? Irgendwer muß ja die vielen kleinen Vermögen bezahlen! Der DGB hat hier konkrete Vorstellungen:
„Neben der Individualvermögensbildung (Sparförderung durch das 624-DM-Gesetz, deren Wirkungslosigkeit allgemein gerühmt wird — d. V.) kommt es darauf an, neue Formen gesellschaftlicher Vermögensbildung in die Arbeitnehmerhand zu verwirklichen, die eine Einflußnahme auf die Unternehmenspolitik im Sinne verteilungs- und gesellschaftspolitischer Ziele ermöglichen. Gesellschaftliches Arbeitnehmervermögen, das zu diesen Zwecken eingesetzt wird, kann im Rahmen eines Fonds-Systems auf der Basis einer überbetrieblichen Ertragsbeteiligung gebildet werden.“ (1/170)
Diese Fonds haben nun zwei Eigentümlichkeiten. Erstens macht sich der DGB die Sorgen der Unternehmer und Eigentümer, die den Fonds bezahlen sollen und behauptet, daß das Investitionsvolumen durch geschicktes Umschichten „zwischen einzelnen Posten der Jahresbilanz zugunsten des Grundkapitals (aus dem der Fonds bezahlt werden soll – MSZ) auf der Passivseite“ (1/171) nicht berührt wird. „Das vorstehend entwickelte Modell einer überbetrieblichen Ertragsbeteiligung führt demzufolge zu keiner ökonomisch begründbaren Einengung des Investitionsspielraums.“ (1/171) Zweitens unterscheidet sich dieses Vermögen von dem normalen, das dem Eigentümer ein angenehmes Leben erlaubt, darin, daß der Arbeiter nach den Vorstellungen des DGB auf keinen Fall persönlichen Nutzen aus seinem Vermögen ziehen darf.
„Die verteilungs- und gesellschaftspolitischen Ziele der Vermögenspolitik können nur auf dem Weg über grundsätzlich ewige Sperrfristen erreicht werden. Einer nachhaltigen Änderung der Vermögensverteilung stehen die gegenwärtigen Konsum- und Spargewohnheiten der Arbeitnehmer entgegen.“ (1/171)
Da die „Arbeitnehmer“ so psychologisch interessante Gewohnheiten haben, das ihnen zur Verfügung stehende Geld gegen Konsumgüter zu tauschen, gilt es, ihr Vermögen vor ihrer Gefräßigkeit zu schützen. Obendrein würde ohne „ewige Sperrfrist“ das Geld dem Betrieb entzogen und dann ginge die Milchmädchenrechnung des DGB unter erstens nicht mehr auf.
Kurz gefaßt: die Arbeiter kriegen praktisch wertlose Zettel, der Sonntagsbraten wächst dadurch ewig nicht, dafür aber der soziale Status. Fehlt nur noch die Vermögenssteuer. Diese erfolgversprechende Vertretung der Interessen seiner Mitglieder führt der DGB in seinen Plänen bis zum Gipfel des Glücks weiter: der vermögende Arbeiter darf seinem Staat dienen.
„Gewinne aus den Unternehmensbeteiligungen werden nicht ausgeschüttet; die Fonds sollen sie zur Finanzierung von Infrastruktur-Investitionen im öffentlichen Bereich zur Verfügung stellen.“ (I/173)
Ziel der Politik des DGB ist zugestandenermaßen also „nicht der unmittelbare Nutzen der Arbeitnehmer“, sondern die Partizipation an der Macht, an den Entscheidungen. Kontrolle der Unternehmer durch alle von den Entscheidungen Betroffenen soll ein besseres Funktionieren der Wirtschaft garantieren. Aber auch in diesem Punkt muß sich der DGB von seiten des Kapitals sagen lassen, daß mit Dreinreden nichts läuft. Anstatt das zur Kenntnis zu nehmen, setzen die Gewerkschaften ihre Macht ein, dem Gegner vorzujammern, daß er seine Gegnerschaft im Zeichen der Vernunft aufgeben soll. So kann er von seinem politischen Standpunkt aus nur polemisieren gegen die, die längst ökonomisch Partei bezogen haben:
„Wenn von Unternehmerseite gleichwohl mit Investitionsbeschränkungen gedroht wird, so handelt es sich um eine ausschließlich politisch motivierte Androhung.“ (1/171)
Die IG Metall, die in der Öffentlichkeit als radikaler Flügel des DGB angesehen wird, hat die Vermögensbildung einer kritischen Würdigung unterzogen und festgestellt:
„Unser Instrument der Einkommensverteilung ist die Aktive Tarifpolitik, nicht die passive Vermögenspolitik. ... Wir (wollen) verhindern, daß uns fiktive Anteile, mit denen der Arbeitnehmer nichts anfangen kann, als Einkommen oder Vermögen zugerechnet werden und unser Verhandlungsspielraum auf diesem Umweg eingeengt wird.“ (I/176)
Weil die Pläne zur Vermögensbildung nicht effektiv sind, nicht greifen, wie es im Fachjargon so schön heißt, ist die IG Metall also dagegen, nicht weil sie plötzlich kapiert hätte, daß solches schlicht arbeiterfeindlich ist. Aus ihrer Kritik der Pläne („Besitztitel, mit denen sie die Wand tapezieren können“, 1/1976) wird der Schluß gezogen:
„Für gesellschaftliche Reformen und gegen vermögenspolitische Scheinlösungen.“ (I/176)
Die Reformfront des DGB steht also, und Mängel gibt es viele. Der DGB nimmt sich dieser an, hat Forderungen zur Steuerpolitik („Erst ein modernes und gerechtes Steuersystem schafft die Voraussetzung für eine eventuelle Steigerung der Steuerlastquote.“ 1/285), zur Umweltpolitik (,,Der DGB betrachtet die zunehmende Verschmutzung und Vergiftung der Umwelt mit großer Sorge.“ 1/306) und zur Regional-, Struktur-, Städtebau- und Wohnungspolitik (1/317ff.) („Das ist ein Kennzeichen unserer Zeit: Wirtschaft, Gesellschaft und das Leben jedes einzelnen wandeln sich immer schneller. ... dies gilt insbesondere für Räume und Regionen, deren Be-siedlungsdichte sich verändert.“ – aus der Präambel des Antrags zu diesem Teil der Reformfront (1/320)
Sozialpolitik: Absicherung des Elends
Der 10. ordentliche Bundeskongreß des DGB, der im Mai 1975 zu Hamburg zusammentrat, gelangte einstimmig zu der bestürzenden Feststellung, daß
„die Bevölkerung der Bundesrepublik in den letzten 20 Jahren nicht gesünder, sondern nachweisbar kränker geworden ist.“ (II/97)
Der DGB hat hier bemerkt, daß seine „Arbeitnehmer“ noch so vorbildliche Staatsbürger, orientiert am Wohl „unserer“ Wirtschaft, werden können, eben dieses Wohl und das Wachstum „unserer“ Wirtschaft sich in den „letzten 20 Jahren“ gegen das Wohlergehen bestimmter Wirtschaftsteilnehmer durchgesetzt hat:
„Man schaue nur einmal hinter die Türen der psychiatrischen Anstalten oder von Obdachlosenasylen (!)“ (I, 204)
Sowohl der Blick hinter die Türen der Klapsmühlen, als auch von Obdachlosenasylen sowie der „hohe Stand der Frühinvalidität bedingt u. a. durch den zunehmenden Streß im Arbeitsleben mit seinen gesundheitsschädigenden Wirkungen“ (11,97) nötigt dem DGB eine scharfe Reaktion ab und bietet ihm Material, sozialpolitisch aktiv zu werden.
Gesundheit = Die Absicherung des Krankseins
Im Zentrum dieses weiten Feldes gewerkschaftlicher Aktivität steht nicht die Sorge um die Gesundheit, sondern um
„die Gesundheit, … eine der wichtigsten Voraussetzungen zur freien Persönlichkeitsentfaltung und zur Verbesserung des sozialen Statuts“ (II, 219)
Weil, wer krank ist, einen unweigerlichen Statusverlust in Kauf nehmen muß, der ihm mit der Rolle des Kranken in der Regel diejenige des Arbeitslosen aufbürdet, der von Fürsorgeleistungen abhängig ist, geht es dem DGB darum, das Kranksein sozial abzusichern. Daß der DGB sich nämlich mit der Tatsache abgefunden hat, daß Lohnarbeit die von ihr Lebenden physisch und psychisch schädigt –
„Die Gesundheit wird in immer stärkerem Maße durch die Belastungen der modernen Industriewelt beeinträchtigt.“ (II, 219) –
taucht als Ergebnis gewerkschaftlichen Kampfes noch in jedem Manteltarifvertrag auf, wenn die „normale Arbeitsleistung“ folgendermaßen festgesetzt wird:
„Normalleistung ist diejenige Leistung, die von ausreichend geeigneten Arbeitnehmern bei voller Übung und ausreichender Einarbeitung ohne Gesundheitsschädigung auf Dauer erreicht und erwartet werden kann.“ (Manteltarifvertrag der Bayer. gew. Metallind., § 19)
Wenn also jede Mehrleistung über die Normalleistung hinaus (dies die Grundlage aller Formen des sogenannten Leistungslohnes) ,,auf die Dauer“ nur mit Gesundheitsschädigung „erreicht und erwartet“ werden kann, dann bleibt den Gewerkschaften, die damit sich wohl im Interesse des Wachstums unserer Wirtschaft abgefunden haben, als Kampfziel nur,
„die Chancen (!) zu ihrer (der Gesundheit — MSZ) Wiederherstellung durch einen Ausbau der Vorsorge, Früherkennung, Behandlung und Rehabilitation entsprechend dem jeweiligen Erkenntnisstand der Wissenschaft für jeden Bürger gleichmäßig (!) zu gewährleisten.“ (II, 1.0)
So wird der Staat Adressat von Forderungen, deren Realisierung in Gesetzen und Vorschriften die Gleichstellung der „Arbeitnehmer“ mit allen anderen Bürgern gewährleisten soll. Die Argumente, deren man sich dabei bedient, stammen aus dem Repertoire der demokratisch-humanistischen Ideologie:
„Die Persönlichkeit- des Arbeitnehmers und seine Menschenwürde sind auch am Arbeitsplatz zu achten. Seine Arbeitskraft darf nicht als Ware gewertet i!) werden. Die Arbeit des Einzelnen ist auch eine persönliche Leistung für die Gesellschaft.“ (I, 53)
Für diese persönliche Leistung für die Gesellschaft hat er ein Recht auf Anerkennung, und dies Recht reklamieren die Gewerkschaften umsomehr für ihre Mitglieder, als sie selbst eine tragende Stütze dieser Gesellschaft sind, deren „Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen“ sie grundsätzlich und entschieden bejahen; sie fordern lediglich, sie ,,besser an die Bedürfnisse und Leistungsmöglichkeiten der Menschen anzupassen.“ (II, 97) Wer einerseits der „Arbeit in der modernen Industriewelt“ die immer häufigere Konsequenz von Krankheit, sogar von Frühinvalidität attestiert, darin aber vor allem ein Problem von Menschenwürde und mangelnder sozialer Anerkennung sieht, für den liegt die Lösung der „gesundheitspolitischen Probleme“ in der Forderung nach einer „Humanisierung der Arbeitswelt“, was auf den Zynismus hinausläuft, den gleichen Arbeitsprozeß, dem man seine unmenschliche Rücksichtslosigkeit gegen die Gesundheit bescheinigt hat, vermenschlichen zu wollen. Die konkreten Forderungen hierzu fallen dann auch entsprechend aus: der DGB fordert Gesetze, die die Betriebe zwingen sollen, „mehr Arbeitsmediziner und Sicherheitstechniker“ anzustellen, also Spezialisten für die Behandlung von Krankheiten, deren Ursachen im Produktionsprozeß liegen, was zwar eine bessere Therapie für die Arbeiter bewirken kann, aber die Akzeptierung der Krankheitsursachen stillschweigend impliziert. Und wer angesichts der hohen Quote von Arbeitsunfällen gerade in der modernen Fließproduktion Sicherheitsingenieure fordert, dem geht es nur noch um die Senkung dieser Quote. Weil jedoch auch solche, durchaus maßvolle Zumutungen, die der Staat hier den Unternehmen abverlangen muß, deren Widerstand hervorrufen, liefert der DGB gleich die Argumente, die der „Kapitalseite“ die erhöhten Kosten schmackhaft machen sollen:
„Durch den ökonomischen Ertrag gesundheitspolitischer Maßnahmen wird auch das Wirtschaftswachstum positiv beeinflußt.“ (II/219)
Altwerden kein Uhrwerk
Zu ähnlich miesen Reformvorschlägen gelangt eine Gewerkschaft, die die soziale Absicherung ihrer Mitglieder über ihre Anerkennung als gleichberechtigte Staatsbürger durchsetzen will, auf allen anderen Gebieten ihrer Sozialpolitik. Aus der unerfreulichen Konsequenz des Lohnarbeiterdaseins, daß seine Reproduktion gefährdet ist, wenn die Quelle ihres Einkommens die Arbeitskraft, versiegt, macht der stellvertretende DGB-Vorsitzende G. Muhr das soziopsychologische Problem,
„daß der Prozeß des Alterns keinem regelmäßig ablaufenden Uhrwerk gleichkommt, sondern von vielfältigen individuellen wie sozialen Faktoren abhängt, welche die Arbeits- und Lebensfähigkeitskurve jedes einzelnen erheblich beeinflusse,“
um daraus die Forderung nach einem „freiheitlicheren und humaneren Übergang vom Arbeitsleben ins Rentenalter“, die „flexible Altersgrenze“ zu begründen. Der dabei für die „Arbeitnehmer“ herausspringende Vorteil, schon mit 60 Rentner werden zu „dürfen“, wird dem Staat, der dies kodifizieren soll, mit dem Argument schmackhaft gemacht, daß das Recht des Arbeiters, „in Würde altwerden“ zu dürfen, natürlich auch die Möglichkeit einschließt, länger im Arbeitsprozeß auszuharren. Daß vorzeitige Ausscheiden derer, die von der „modernen Arbeitswelt“ schon vor Erreichung der 65-Jahres-Grenze geschafft werden, wird zumindest teilweise von denen kompensiert, die länger malochen wollen und die dies – nach den DGB-Vorstellungen – jetzt auch dürfen sollen (sicherlich nicht wenige, hält man sich die Freuden des Rentnerdaseins vor Augen!). Daß, wer von seiner Arbeitskraft lebt, im Alter mit dem Leben Schwierigkeiten hat, taucht also in der DGB-Sozialpolitik als Forderung nach einem Recht auf „soziale Absicherung des Alters auch (!) für Arbeitnehmer auf; daß Arbeiter billig wohnen müssen, vertritt der DGB als „Recht jedes Menschen auf Wohnung“ und daß das Arbeiterdasein mit solch unangenehmen Begleiterscheinungen, wie „Unfall, Arbeitslosigkeit, Berufs- und Erwerbsunfähigkeit“ verbunden ist, mystifiziert der DGB zu „verschiedenen Lebensrisiken“ und verlangt vom Staat „ein umfassendes System der sozialen Ordnung“, wobei die Großschreibung des Attributs signalisiert, worauf es ihm ankommt: gerecht soll es zugehen und diesem Ziel ordnet sich auch die Sozialpolitik des DGB unter:
„Bei Bismarck ging es noch um die Reparatur von Schäden im sozialen Bereich, um damit die gegebene gesellschaftliche Ordnung zu konservieren. Heute kommt es darauf an, die Ursachen sozialer Notstände zu beseitigen und diese Ursuchenbeseitigung einzuordnen in die Bestrebungen zur Veränderung der Gesellschaftsordnung.“ (1,204)
Mitbestimmung: Die Demokratie ist unteilbar!
Zu welchen Höhepunkten der Radikalität gewerkschaftliche Gesellschaftsveränderung gelangt, zeigt das Herzensanliegen gewerkschaftlicher Reformpolitik, die Mitbestimmung.
„Die soziale Lage der Arbeitnehmer ist auch bei uns immer noch dadurch gekennzeichnet, daß er gezwungen ist. wo immer er auch arbeitet, in eine Unternehmungsordnung einzutreten, in der die Beteiligungsrechte an der unternehmerischen Verfügungsgewalt ungleich verteilt sind.“ (I, 137)
Woran mag das wohl liegen?
„Nur die Kapitaleigner oder ihre Beauftragten verfügen über ein volles Bestimmungsrecht im Unternehmen.“ (a. a. O.)
Und woher kommt denn das?
,,Aus dem Eigentumsrecht folgen selbstverständlich auch Verfügungsrechte. Es folgt daraus jedoch nicht das Recht, daß andere Menschen gehalten sind, sich dem Eigentümer zur Nutzung seines Eigentums zur Verfügung zu stellen und sich dabei zu ihm in ein Unterwerfungsverhältnis zu begeben.“ (a.a.O.)
Klar, Arbeitspflicht gibt's nur im Faschismus; in der Demokratie muß keiner arbeiten, er kann genauso gut verhungern, klauen, Lottospielen etc. Da dies aber keine allzu verlockenden bzw. aussichtsreicheren Perspektiven sind, unterwerfen sich die meisten Proleten den Eigentümern der Produktionsmittel. Warum?
„Daß heute immer noch dies in allergrößtem Umfang geschieht, ist kein Ausfluß des Eigentumsrechts an den Produktionsmitteln, sondern (?) die Folge der Tatsache, daß die Arbeitnehmerschaft gezwungen ist, ihren Lebensunterhalt in unselbständiger Erwerbsarbeit zu verdienen.“ (a. a. O.)
Und nun der messerscharfe Schluß:
„Die Alleinherrschaft des Unternehmers hat demnach ihre Ursache nicht im bestehenden Eigentumsrecht, sondern in der wirtschaftlichen Schwäche derer, die darauf angewiesen sind, von unselbständiger Arbeit zu leben.“ (a. a. O.)
Der DGB will nichts gegen den Staat und die Unternehmer unternehmen und erfährt in seinem Unterfangen, aus seiner Gegnerschaft zu ihnen ein friedliches Miteinander zu machen, von beiden Partnern, daß er selbst noch um die Auflösung der Gegnerschaft kämpfen muß. Deshalb kann er auch um seine Mitwirkung am Staat und bei der Kapitalverwertung gar nicht kämpfen, weil jeder Kampfakt seine Bereitschaft zur Mitwirkung in Frage stellt. Er beschränkt sich also darauf, seine Gegner zu agitieren.
Allen wohl und nur den Radikalen weh
Deshalb verweist er auf die Vorteile der Mitbestimmung für Staat und Unternehmer und kann sich auf das Beispiel der Montanindustrie berufen, wo sie schon seit langem paritätisch praktiziert wird:
„Dies betrifft sowohl die Einführung des technischen Fortschritts, die außerordentliche Steigerung der Produktivität, die Umstrukturierung der Beschäftigten sowie den Ausbau rationeller Betriebs- und Unternehmensformen.“ (a. a. O.)
Bei solchem Fortschritt ist es auch nicht verwunderlich, daß es kaum zu Kampfabstimmungen in den Mitbestimmungsgremien kam, wobei sich zeigt,
„daß konstruktive Lösungen möglich sind, da über umstrittene Fragen vor entscheidenden Sitzungen bei internen Beratungen Übereinstimmung erzielt wurde.“ (I,140 F.)
Dieses fröhliche Bekenntnis zu gewerkschaftlicher Mauschelei mit den Kapitalvertretern macht auch den gemeinsamen Gegner kenntlich, den man mit der Mitbestimmung niederhalten kann:
„Ohne die gleichberechtigte Beteiligung der Arbeitnehmer an wichtigen Unternehmensentscheidungen wäre eine politische Radikalisierung kaum zu vermeiden gewesen, wie die Probleme anderer Länder zur Genüge zeigen.“
So bringt die Mitbestimmung nicht nur, was alle wollen: eine prosperierende Wirtschaft, sie verhindert auch, was man gemeinsam fürchtet: Klassenbewußtsein bei den Arbeitern.
Mitbestimmung über die Ausbeutung
In ihren Mitbestimmungsforderungen plaudert der DGB naiv sein Ziel aus: der Nutzen seiner Mitglieder ist optimal realisiert, wenn die Unternehmen florieren, Mitbestimmung die „Selbstbestimmung“ über die Konditionen der eigenen Ausbeutung ist, die ja die Quelle dieses Florierens ist. So muß diese Gewerkschaft das Festhalten der Arbeiter an ihren Interessen auch gegen diejenigen der Kapitalseite (sprich Unternehmen) als unerwünschte „politische Radikalisierung“ bekämpfen, und alles und jedes, was das Getriebe der Wirtschaft stört, wird ihr zum Argument für die Notwendigkeit von Mitbestimmung. H. O. Vetter pries auf der DGB-Großkundgebung am 8. November in Dortmund die Mitbestimmung als Weg aus der Krise an: „Hätten wir diese Mitbestimmung (das Montan-Modell – MSZ) schon in der gesamten Wirtschaft, dann wäre die weltweite Wirtschaftskrise zwar nicht verhindert worden, aber sie hätte in der Bundesrepublik mit Sicherheit einen anderen Verlauf genommen.“ („Die Quelle“. Funktionärszeitschrift des DGB. November 1975) |
 |
Schlagendes Beispiel: im Montanbereich wurde nicht soviel entlassen, sondern kurzgearbeitet, VW, nicht mitbestimmt, entließ und muß jetzt wieder Arbeiter einstellen. Es kommt den Staat wesentlich billiger, wenn er statt Arbeitslosengeld nur Kurzarbeitsausgleich bezahlen muß, ganz abgesehen davon, daß es auch betriebswirtschaftlich rationeller ist, weshalb auch eine ganze Reihe nicht mitbestimmter Betriebe dem „Montanmodell“ gefolgt sind, worüber H. O. Vetter eine Erklärung für unnötig hält, hätte ihm sonst doch auffallen müssen, daß Entscheidungen dieser Art im Unternehmensinteresse fallen, und da war halt bei VW die Entlassung mit Rationalisierungsmaßnahmen gekoppelt, deren Notwendigkeit sich IG-Metall-Chef Loderer im VW-Aufsichtsrat ebensowenig verschloß, wie die Gewerkschafter in Montanunternehmen ihre Zustimmung dem Lohnabzug verweigerten, der Kurzarbeit für die Arbeiter auch dann bewirkt, wenn sie im Unternehmensinteresse und nicht nur in dem der Unternehmer eingeführt wird.
Wenn Mitbestimmung heißt, über das Wohl und Wehe des Unternehmens mitzureden und entscheiden zu dürfen, dann will sie das Eigentum der Kapitalisten befördern und Arbeiter, die sich freiwillig der betriebswirtschaftlichen Rationalität unterwerfen, arbeiten einerseits williger und haben andererseits keinen Grund mehr, Verluste am Reallohn bzw. gar des Arbeitsplatzes dem Kapital anzulasten, sind sie doch selbst an den Entscheidungen beteiligt gewesen, die diese unangenehmen Folgen nach sich zogen.
Die Gegner der Mitbestimmung
Mag nun der Staat die mit der Mitbestimmung erreichte „Stellung der arbeitenden Menschen“ durchaus im Sinne der „Demokratisierung aller gesellschaftlichen Bereiche“ goutieren — was sich daran zeigt, daß die DGB-Vorschläge in beiden großen Parteien Förderer fanden – so können die Unternehmer sich aus verständlichen Gründen damit nicht anfreunden: Wie sie mit ihrem Eigentum optimal disponieren, das glauben sie allemal am besten selber bestimmen zu können und da sie – mit Ausnahme schrulliger Sonderlinge vom Schlag des Weinkellerers Elmar Pieroth, der sich als Eigentümer eines voll mitbestimmten Betriebes am rechten Flügel der CDU heimisch fühlt – im Unterschied zu den DGB-Gewerkschaften noch über soviel Klassenbewußtsein verfügen, daß sie ihren Vorteil als Gegensatz zu dem ihrer Arbeiter wissen, steigert sich ihr Unbehagen zur hysterischen Gegnerschaft, wenn sie an Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat denken, die auch einmal am Interesse derer, die sie vertreten, dergestalt festhalten können, daß sie nicht mehr mitbestimmen, sondern dagegenstimmen. Selbst der jetzt Gesetz gewordene Mitbestimmungsschlüssel provozierte Unternehmerideologen zu der besorgten Frage, wie denn mit etwaigen „Verfassungsfeinden“ in Mitbestimmungsgremien zu verfahren sei.
Schwierigkeiten in den eigenen Reihen
Neben diesem Gegner sieht sich der DGB mit Schwierigkeiten konfrontiert, die er in den eigenen Reihen vorfindet: die in ihm organisierten Arbeiter haben größtenteils andere Sorgen als die Mitbestimmung, zumal in den gegenwärtigen schlechten Zeiten, wo sie fast ausschließlich an ihren Lohn denken, der hinten und vorne nicht ausreicht. Der DGB muß also seine eigenen Mitglieder für sein Anliegen agitieren und gibt damit denen recht, die in der Mitbestimmung einen Machtanspruch der Gewerkschaftsfunktionäre wittern und vor einer drohenden Entwicklung zum Gewerkschaftsstaat warnen. So ist der DGB in der verzwickten Lage, einerseits den Arbeitern, die in der Mitbestimmung keinen unmittelbaren Vorteil für sich sehen können, zu verklickern, daß sie wenigstens für die Stärkung ihrer Gewerkschaften via Mitbestimmung sich einsetzen müssen und zugleich einer mißtrauischen Öffentlichkeit zu versichern :
„Wir sind für nichts und niemanden ein Hindernis.“ –
andererseits zu drohen, die anderen hätten Schuld und es sich selber zuzuschreiben, wenn es anders komme, als die Gewerkschaften und eigentlich alle es wollten:
„Wenn die Mitbestimmung nicht kommt oder nur unvollständig oder verfälscht kommt, dann werden die drängenden wirtschaftlichen Probleme nicht gelöst, sondern ihre Lösung wird verschleppt. Dann wird das soziale Klima in unserem Lande mit Sicherheit wieder rauher werden.“ (II. O. Vetter, 1. c.)

Kämpfen, um nicht mehr kämpfen zu müssen
Die Albernheit dieser Drohung liegt in der Unterstellung, daß sich Staat und Kapital starke Gewerkschaften, viel Rechte der organisierten Arbeitnehmer wünschen sollen, weil dann, von den Arbeitern nichts zu fürchten ist, Friede und angenehmes soziales Klima herrscht, andererseits gerade schwache Gewerkschaften den Klassenkampf provozieren.
Hier zeigt sich, daß für den DGB die Aufgabe des gewerkschaftlichen Kampfes zur Aufgabe geworden ist: wenn westdeutsche Gewerkschaften drohen, dann drohen sie nicht mit den Arbeitern, die hinter ihnen stehen, sondern mit den Arbeitern, die nicht mehr hinter ihnen stehen werden! Eine Gewerkschaft, der es um die „Auflösung von Konflikten in Betrieb und Unternehmen,“ um die „menschliche und gesellschaftliche Bewältigung der Probleme zwischen Arbeit und Kapital“, um die „Lösung der sozialen und wirtschaftlichen Probleme unseres Landes“ geht, und die dadurch die Interessen ihrer Mitglieder vertreten will, will gerade nicht mehr konsequent an den Interessen der Arbeiter festhalten und sie gegen Kapital und Staat durchzusetzen versuchen, stattdessen hat sie das Ganze im Auge behalten. Ihr Standpunkt ist nicht mehr derjenige der Arbeiterklasse, sondern sie steht über den divergierenden Interessen, die zu den von ihr beklagten Konflikten führen und die die „drängenden Probleme“ aufwerfen: sie macht sich das Interesse des Staates zu eigen. So erklärt sich auch die überraschende Pointe in Vetters Rede: „...wir werden nicht aufhören, weiter für echte Mitbestimmung zu kämpfen.“ (a. a. O.) Und so kämpft denn der DGB um die Anerkennung seiner politischen Partizipation, um eine Form der Gewerkschaftspolitik, die ihm das Kämpfen erspart. „Für uns ist Demokratie unteilbar.“ (a. a. O.)
Die politisierte Gewerkschaft: Motor des gesellschaftlichen Fortschritts
Wir haben gesehen, wie der DGB den gewerkschaftlichen Kampf in ein „verantwortungsbewußtes Ringen um mehr Demokratie“ auflöst, um „soziale Anerkennung der Arbeitnehmer“, denen ein „menschenwürdiges Dasein“ dadurch zuteilwerden soll, daß sie als Staatsbürger gleichberechtigt mit anderen Gruppen der Gesellschaft behandelt werden. Mit dem staatlichen Ideal der Gleichberechtigung als Maxime gewerkschaftlichen Handelns erkennt der DGB die kapitalistische Ausbeutung an und propagiert die Mitverantwortung der „Arbeitnehmer“ über deren optimales Funktionieren. Angesichts dieser Praxis der DGB-Gewerkschaften nehmen sich Auslassungen ihres Vorsitzenden zum Prinzip der Gewerkschaften wie Rückfälle in Klassenkampfdenken aus:
„Fragen wir uns nach den Grundlagen der Gewerkschaftsbewegung, so stehen wir heute wie vor hundert Jahren vor demselben Tatbestand: der sozialen Unterlegenheit und Abhängigkeit des Arbeitnehmers. Er muß seine Arbeitskraft verkaufen, um den für sich selbst und seine Familie notwendigen Lebensunterhalt zu decken. Als einzelner auf sich allein gestellt, ist er der Übermacht derer ausgeliefert, die über Kapital und Eigentum an den Produktionsmitteln verfügen...Nur kollektiv können wir der gesellschaftlichen Übermacht der Gegenseite eigene Macht entgegenstellen. Dies sind die Grundlagen des gewerkschaftlichen Zusammenschlusses: sie sind bis in die Gegenwart im Prinzip unverändert.“ (1/66)
Nun geht es H. O. Vetter offensichtlich nicht darum, auf den Widerspruch von Lohnarbeit und Kapital hinzuweisen, um die Arbeiter aufzufordern, sich gegen ihre physische und psychische Zerstörung im Produktionsprozeß zur Wehr zu setzen und so die Notwendigkeit der Koalition der Lohnarbeiter zu begründen, denn diese gibt es ja: die westdeutsche Gewerkschaftsbewegung, ist sicherlich der stärkste und einflußreichste Zusammenschluß in der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung und es besteht für den Vorsitzenden dieser Organisation kein Grund, irgendjemanden von der Notwendigkeit der Gewerkschaft zu überzeugen, weder die Arbeiter, die ja größtenteils in ihr organisiert sind, noch die Unternehmer, die sie als Tarifpartner akzeptieren, geschweige denn den Staat, der in ihnen längst eine unverzichtbare demokratische Institution würdigt. Worum also geht es Vetter? In der zitierten Rede macht er sogleich deutlich, wogegen er sich richtet:
„Immer wieder wird der Versuch unternommen, die Aufgaben der Gewerkschaften um den politischen Auftrag zu verkürzen.“ (a.a.O.)
Eine Gewerkschaft, die sich „schon immer...als Motor des gesellschaftlichen Fortschritts verstanden hat“, weist Staat und Gesellschaft nachdrücklich darauf hin, daß es sie gibt, und der Grund für ihre Existenz gilt ihrem Vorsitzenden als Argument dafür, daß sie auch etwas anderes machen darf, sich um Staat und Gesellschaft kümmern, ist sie doch – so steht es schon im Grundsatzprogramm – „durchdrungen von der Verantwortung gegenüber ... dem ganzen Volke.“ (1,45) Wenn die DGB-Gewerkschaften also durch ihre Teilnahme an der „konzertierten Aktion“ sich die Sorgen des Bundesministers für Wirtschaft zu eigen machen, ihre Forderungen mit den Anliegen unserer Wirtschaft konzertieren (deutsch: in Einklang bringen), dann geschieht dies mit dem Argument,
„daß die Möglichkeiten von Schutz, Sicherung und Entfaltung des einzelnen immer weniger von ihm selbst oder nur und ausschließlich durch die Tarifpolitik der Gewerkschaften beeinflußt werden kann. Wenn die Stellung der abhängig Beschäftigten durch das Bildungsangebot, die Verkehrslage...usw. weitgehend vorherbestimmt sind, dann müssen sich die Gewerkschaften ebenfalls um diese ursprünglich staatlichen Aufgaben kümmern.“ (I,40)
Aus der Bedingung gewerkschaftlichen Kampfes, der Beschränkung der Lohnarbeiter durch den Staat, ist Zweck und Ziel der Gewerkschaft geworden. Der Inhalt des gewerkschaftlichen Kampfes – Erhalt der Reproduktion der Lohnarbeit – erhält so die perverse Form, daß nicht mehr die Interessen der Lohnarbeiter Grundlage der gewerkschaftlichen Aktivitäten bilden, sondern die „Gestaltung“ (sprich Erhaltung) des Staates, der „Fortschritt der Gesellschaft“, wodurch die Interessen derer, die im DGB organisiert sind, „vorherbestimmt“ werden. Nun muß der DGB bemerken, daß staatliche Maßnahmen, auch wenn sie von einer SPD-dominierten Regierung vorgenommen werden, halt staatliche Maßnahmen, d. h., dem „Allgemeinwohl“ verpflichtet sind, und das fällt nicht mit den Staatsvorstellungen der Gewerkschaften zusammen, wie nicht nur das „Krisenmanagement“ der Bundesregierung mit seinen „Konjunkturspritzen“ für Unternehmer und der sozialen Demontage an den Staatsleistungen für Lohnarbeiter zeigen, sondern auch die Form, die gewerkschaftliche Forderungen erhalten, wenn sie als Gesetze kodifiziert werden. Dies hat die Konsequenz, daß die Gewerkschaften auf den Klassenfeind vermittelt über den Staat gestoßen werden: staatliches Handeln sieht sich nicht nur den Wünschen der „Arbeitnehmer“ konfrontiert, sondern auch mit den sehr wirkungsvoll und druckkräftig vorgetragenen der Kapitalseite.
Dies prägt auch die Auseinandersetzung der Gewerkschaften mit den Kapitalisten: an deren staatsbürgerliche Verantwortung wird appelliert, wenn sie die Interessen der Gewerkschaften allzu arg beschneiden wollen, und die eigene „Verantwortungsbewußtheit“ wird ihnen mahnend vor Augen geführt. Westdeutsche Gewerkschaften drohen so immer mit der Gefahr einer „Verschlechterung des sozialen Klimas“, die sie keinesfalls wollen, die ihnen „aufgezwungen“ wird. Selbst die Anwendung der wirkungsvollsten Waffe des gewerkschaftlichen Kampfes, des Streiks, wird so dem DGB zur „aufgezwungenen“, ihm selber widerwärtigen „Störung des Arbeitsfriedens“, den die anderen zu „verantworten“ haben. Wenn man nämlich „auf demokratische Weise eine humane Ordnung herbeiführen“ (I, 37) möchte, dann geht das sicherlich nicht — dies die Logik des gewerkschaftlichen Bewußtseins — über die kämpferische Durchsetzung der Arbeiterinteressen auf Kosten der Unternehmer oder gar des Staates, sondern nur durch den harmonischen Interessenausgleich, bei dem denen, deren Interessen ausgeglichen werden, von ihrer Gewerkschaft vorgemacht werden muß, letztlich habe es ihnen um's Ganze zu gehen und darin liege eigentlich ihr Vorteil — wenn schon nicht als Arbeiter, so auf jeden Fall als Staatsbürger und Demokraten. So erklärt sich auch, warum der DGB sich Sorgen u. a. auch um Bildung und Kultur seiner Mitglieder machen muß. Als Interessenvertreterorganisation hat er das Problem, seine Mitglieder erst einmal dahingehend zu agitieren, daß sie auch die richtigen Interessen haben. Er muß seine eigene Politisierung zur Institution des demokratischen Staatswesens an seinen Mitgliedern durchsetzen: der Lohnarbeiter muß seine Fixierung auf den Lohn abstreifen und andere Sorgen kriegen, seinen Materialismus durch den Staatsidealismus korrigieren, er muß sich vom Proleten zum Demokraten mausern. Für diesen Wandlungsprozeß ist der alte Marx brauchbar: an seinen Anliegen läßt sich herausstreichen, daß man sie heute nicht mehr hat. So muß der einfache Arbeiter, um ein voll anerkannter, gleichberechtigter, „emanzipierter“ Bürger unseres Staatswesens zu werden, natürlich auch eine Kultur haben. Diese offeriert ihm der DGB im Rahmen seiner Kulturpolitik, die
„alle geistigen und sittlichen Kräfte fördern will, die demokratisches Bewußtsein und Gemeinsinn zu bilden vermögen und die Verwirklichung des sozialen Gedankens in der Demokratie verbürgen.“ (I, 58)
Von dieser Warte nimmt der DGB zu allen kulturellen Fragen Stellung (Film, Medien, Hochschule usw.), Marx taucht hier als Teil des „humanistischen Erbes“ auf und der DGB macht auch selber Kultur, sei es als Pflege der Tradition (Ruhrfestspiele, wo die Kumpels sich in Anzüge zwängen müssen, um bei Goethe und Schiller zu erfahren, daß man als gebildeter Mensch auch andere Sorgen haben kann, als die Sorge ums Überleben) oder als Förderung einer „Kunst der Arbeitswelt“, wo sich der Prolet nach Feierabend seine alltägliche Scheiße als Kultur vorführen lassen soll.
Der Erste Mai: Selbstdarstellung des DGB und seiner Gegner
Zu guter Letzt erklärt sich hier auch das alljährliche Spektakel gewerkschaftlicher Maiveranstaltungen als Höhepunkt der Agitation westdeutscher Gewerkschaften. Zur Funktion des 1. Mai hat der DGB auf seinem letzten Bundeskongreß im Rahmen der Anträge „Werbung (!) – Medienpolitik“ folgendes beschlossen:
„Eine historische Bewegung erfährt ihre entscheidenden Impulse nicht nur aus rationalen Erwägungen ihrer Mitglieder, sondern auch aus dem Erlebnis der Solidarität. Deshalb muß sie ihre Ziele und Aufgaben symbolhaft darstellen und in eine gemeinsame Tradition der Gewerkschaftsbewegung einordnen. Traditionen führen jedoch zur Erstarrung, wenn sie nicht ständig erneuert werden. Dieser geschichtliche Prozeß der Traditionserneuerung muß in jeder Mai-Veranstaltung verwirklicht werden ... Der Verkauf von Mai-Abzeichen wird wieder zugelassen.“ (II, 180)
Wenn es dann heißt:
„Am 1. Mai demonstrieren die gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmer gegenüber der Öffentlichkeit und den Unternehmern ihre Stärke und Geschlossenheit.“(a.a.O.)
so machen das die DGB-Gewerkschaften nicht durch Kampfmaßnahmen gegen das Kapital und seinen Staat, sondern dadurch, daß sie Staatsmänner die „gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmer“ wegen ihrer Leistung für Staat und Gesellschaft loben und ermuntern lassen, darin fortzufahren, auch und gerade dann, wenn – wie 1976 – diese Leistungen weniger honoriert werden können. Ihre eigenen Redner beteuern ihre Loyalität zum Staat und erweisen sich stark in dem solidarisch abgelegten Versprechen, auch weiterhin „für nichts und niemanden ein Hindernis“ sein zu wollen.
Stellen sich am 1. Mai die westdeutschen Gewerkschaften so dar, wie sie sind, politische Gewerkschaften, Staat und Gesellschaft verpflichtet, die die Interessen ihrer Mitglieder in diesem Sinne (nicht) vertreten, so ist dieser 1. Mai auch ein Feiertag der linken Gewerkschaftsfeinde vom SB bis hin zur KPD/ML, was sich schon daran zeigt, daß ihr Auftritt genauso zur DGB-Kundgebung gehört wie eine Schlägerei zu einer gelungenen Bauernhochzeit: ihre Gewerkschaftsopposition richtet sich nicht gegen die Aufgabe des gewerkschaftlichen Kampfes zugunsten eines „politischen Mandats“ des DGB zur Mitgestaltung von Staat und Gesellschall. Im Gegenteil: auch sie wollen samt und sonders die Arbeiterkoalition für Ziele funktionalisieren, die nichts mit deren Aufgaben als Interessenvertretung der Lohnarbeit zu schaffen haben – so der Kampf für ein „vereinigtes, unabhängiges, sozialistisches Deutschland“ und derjenige gegen die „Hegemoniebestrebungen des Sozialimperialismus“ oder die Bemühungen des „Sozialistischen Büros“ um ,, soziologische Phantasie und exemplarisches Lernen“, die man bei O. Negt nachlesen kann, usw. Was sie vom DGB unterscheidet, ist nicht der Kampf um einen besseren Staat und eine wahre Demokratie, sie stellen sich lediglich einen anderen Staat und eine andere Demokratie vor, als die Gewerkschaftsideologie es sich ausmalt. Der donnernde Applaus, den der DGB-Vorsitzende alljährlich erhält, wenn er zu Beginn der Maikundgebung sich von „Chaoten und Sektierern“ distanziert, die mit den Gewerkschaften etwas anderes im Sinne haben als er selbst und seine „lieben Kolleginnen und Kollegen“, zeigt, daß die staatsbürgerbildende Arbeit des DGB erfolgreich verlaufen ist und die Kritik der westdeutschen Gewerkschaftsbewegung diejenige des Bewußtseins ihrer Mitglieder einschließt.
aus: MSZ 10 – April 1976