 |
 |
Demokratische Bewußtseinsbildung für die Elite und fürs Volk
Der Spiegelleser ist ein Mensch, der sich dem Rest der Menschheit überlegen dünkt, weil er sich mit der „wöchentlichen Pflichtlektüre“ des Blattes – die im allgemeinen zwei Stunden und vierzig Minuten“ (11,7) in Anspruch nimmt – in Stand setzt, durch kritische Kommentare seinem „starken Interesse an Politik und Wirtschaft“ (11,21) Ausdruck zu verleihen. Doch nicht zufrieden damit, sich selbst für „vielseitig interessiert, kritisch, gebildet, selbstbewußt und dynamisch“ (II, 23), kurz, für einen politischen Menschen halten zu können, sind ihm die restlichen 87,7 % des Volkes ein Greuel, weil sie nicht wie er der Pflicht der eigenen Politisierung durch Spiegellektüre nachkommen, sondern die Bildzeitung lesen. Diese verhindere die Politisierung der Massen durch Manipulation, lautet das entrüstete Urteil eines ungarischen Spiegellesers über die Funktion der Bildzeitung:
„Und darum meine ich, daß die Schichten, die heute noch die Bildzeitung lesen und, wie der Spiegel einmal geistvoll (!) geschrieben hat, Gartenzwerge in ihrem Garten haben“ (anstatt Lukacs’ »Ästhetik« zu lesen), „daß sie kaum den Sprung vom Gartenzwerg zum Kampf gegen die Manipulation machen würden. Dagegen ist absolut nicht ausgeschlossen, daß in den relativ breiten Schichten, in denen die Unzufriedenheit sich auszubreiten beginnt, der Ansatz zu irgendeiner Form der Massenbewegung gegen die Manipulation gewonnen werden kann“ (die Aussichten stehen nicht schlecht, wenn es gelingt, den relativ breiten Schichten der Steuerzahler ihre Unzufriedenheit als manipulierte einzureden). „In welcher Form, das kann ich nicht sagen, Ich bin leider nur Philosoph und nicht Politiker ...“ (Lukacs, in: Gespräche mit Lukacs, Reinbek 1967)
Dr. Lieschen Müller und Lieschen Müller
So fand sich eine Schicht, die ihr kritisches Spiegelbewußtsein um das dem Spiegel fehlende Engagement ergänzte und die Springerkampagne „als exemplarischen Kampf gegen die Sphäre der Manipulation“ (IV, 1) initiierte, um die Massen aus ihrem dumpfen Bewußtsein zu reißen, weil sie in deren kritischer Stellung zur Demokratie die Bedingung der Demokratisierung einer Gesellschaft sahen, „die sich für pluralistisch hält“ (IV, 6). Mit dieser Kampagne für die Verwirklichung der freien Meinung ernteten sie allseits Undank. Die Bildleser empörten sich über den Angriff auf ihre Zeitung, die ihnen als Hüterin der bestehenden Ordnung unentbehrlich war, um sich in einem Staat zu Hause zu fühlen, dessen demokratische Regierung ihnen im schlappen Umgang mit den Krawallmachern allen Anlaß zur Unzufriedenheit bot:
„Sind wir denn eine Apfelsinen-Republik, in der man Recht und Gesetz, Autorität und Ordnung unter fadenscheinigen Vorwänden mit Füßen treten darf?“ (III, 55) –
und sahen sich in ihrer Auffassung bestätigt, daß jede Form von Kritik am Staat dessen Zersetzung im Sinn habe. Und auch der Spiegel, der ihnen ihr demokratisches Problembewußtsein geschärft hatte, bedachte sie nicht mit Lob, sondern Spott, so daß sie sich enttäuscht von ihm abwenden mußten:
„Was für Lieschen Müller Bild ist, ist für Dr. Lieschen Müller der Spiegel.“
Auf der einen Seite besteht der schöne Erfolg der Springerkampagne darin, daß heute Schüler Bild statt Faust analysieren müssen, um Manipulation in ihr aufzuspüren – mit dem Ergebnis, daß sie einerseits die von Bild Gegängelten als Untermenschen betrachten, denen unverbildete Analphabeten in Afrika oder sonstwo vorzuziehen sind, und sie andererseits sich selbst zur eigenen Meinung beglückwünschen, die sie sich aufgrund regelmäßiger Lektüre eines seriösen „Nachrichtenmagazins“ erwerben. Auf der anderen Seite steht auch im Verlauf der „neuen Studentenbewegung“ eine Anti-Augstein-Kampagne nicht zu erwarten, da – neben der rechten Kritik am Spiegel, seine Kritik sei nicht konstruktiv – aufrechte Demokraten den Spiegel allenfalls mit dem vernichtenden Vorwurf schlagen, er beziehe „keine Position“ (I, 90), und sei daher „kein Nachrichtenmagazin“ (I, 100). So bedauert ein deutscher Spiegelleser, daß der Spiegel nicht in all seinen Artikeln das Engagement an den Tag legt, das die Leitartikel des Herausgebers in ihrer „entschiedenen Subjektivität“ (I, 89) auszeichnet, sondern in den Stories
„Information und Kommentar derart in die Masche verstrickt sind, daß sie sich nicht mehr trennen lassen.“ (I, 83)
In der Begeisterung, selbst einen Standpunkt bezogen zu haben, ist ihm die Position des Spiegel entgangen, alle Positionen zu relativieren und mit dem ironischen Begutachten der Staatsgeschäfte den Moralismus zur überlegenen Distanzierung zu verfeinern – nicht ohne jedoch gelegentlich zu demonstrieren, daß man auch die plumpere Variante beherrscht.
Der Spiegelleser hat also aufgrund der Lektüre seines Schundblattes dem Bildleser voraus, sich seine Staatstreue auf gar nicht gartenzwerggemäße lustvolle Weise zu Gemüte führen zu können. Nicht nur in ihren Vorurteilen über die feindliche Zeitung – während Spiegelleser Bild als „niveauloses Blatt“ beschimpfen, das durch unpolitische Unterhaltung manipuliere, ärgern sich Bildleser über die besserwisserische „zersetzende“ Kritik des Spiegel, da sie in ihr einen Angriff auf den Rechtsstaat vermuten – , sondern auch in ihrem ebenso interessierten Urteil über die eigene Zeitung verraten sie jedoch, daß eines für sie nicht zur Debatte steht: der Staatsbürger hat sich je nach seiner Schichtenzugehörigkeit eine Meinung zu bilden:
– Spiegel:
„Denken wir das Dasein des Spiegel weg, so wäre die Wahrheit in Deutschlang außerordentlich viel ärmer und machtloser.“ (II, 9)
– Bild:
„Der engagierte Bildleser ist auf die Zeitung im echten Sinne »angewiesen«. Er bedarf täglich ihrer normativen Funktionen, ebenso wie der Möglichkeit zur Entlastung von Spannungen und unverbindlicher Unterhaltung.“ (IV, 105)
I. Marxistische Entfremdung und Iwan in der Sowjetzone
Eine eigene Meinung braucht der deutsche Mensch, wenn er z.B. der Gefahr des drohenden Weltkommunismus begegnen will. So sind sich Spiegel- und Bildleser darin eins, Kriege gegen diesen Aggressor zu begrüßen, der es auf den Westlichen Wohlstand abgesehen hat, weil er selbst keinen anständigen Reichtum zustandebringt – so daß Bild die amerikanischen Kriegstaten in Vietnam gar nicht drastisch genug nachempfinden kann:
„Napalm! Das Flammenöl räuchert die Widerstandsnester der Kommunisten im Trümmerfeld der Zitadelle aus.“ (24.2.68),
und auch Augstein keine Schwierigkeit hat, dieselbe Position zu verdeutlichen:
„Nixon und Kissinger hatten gar keine Wahl ...“ (15/75) –
und sich dem Gewaltrausch mit kritischen Bedenken hinzugeben, weil ihm die Gewalt nie effektiv genug eingesetzt wird:
„Hätten die USA nur Geld und keine Truppen geschickt, wären dem Volk von Nord- und Südvietnam unendliche Leiden erspart geblieben. So aber wurde Thieus Niederlage die des großen weißen Vaters in Washington.“ (ebd.)
Zu viele Arbeitsplätze – zuwenig Schokoladenhasen
Wenn gerade mal kein Vietnamkrieg stattfindet, an dem sich das Nationalbewußtsein schärfen läßt, so liefert „das riesige Konzentrationslager der Sowjetzone“ (Bild/14.8.61) mitsamt ihren Besatzerstaaten das unausschöpfliche Material für den beständigen Systemvergleich, um den Deutschen zu beweisen, daß es ihnen blendend geht. Für Bildleser genügt es, wenn man ihnen einbleut, daß sie sich der Unbescheidenheit ihrer Ansprüche schämen und stattdessen auf den hiesigen Lebensstandard, zu dessen Erhöhung die eigene Leistung gar nicht hoch genug sein kann, stolz sein sollen:
1965:
„Ostberlin ohne Schokoladenhasen.
Einheitsei für 13,70 DM
Ist Ostern ohne Schokoladenhasen denkbar?
In Ostberlin ist das keine Frage. Es gibt keine Schokoladenhasen – basta. Der schwerfällige Versorgungsapparat hat sich abermals blamiert. Und er (!) beantwortet zugleich die Frage, wieweit sich die Verhältnisse in der Zone in der letzten Zeit verbessert haben. Ein Gang durch Ostberliner Geschäfte bewies: Nach wie vor sitzt König Mangel auf dem Thron ... An unseren Verhältnissen gemessen ein trostloses Bild.“(17.4.)
1977:
„Erst in 60 Jahren wohnt Iwan so gut wie Fritz Müller. Kaum noch tausend Tage bleiben Moskaus Parteiführern, um zu beweisen, daß sie vor sechzehn Jahren den Mund nicht zu voll genommen haben: Damals – im Parteiprogramm von 1961 – wurde erklärt, daß die Sowjetunion die USA in der Pro-Kopf-Produktion der Bevölkerung bis 1980 überholen werde. Inzwischen ist sicher, Moskau kann es gar nicht mehr schaffen.
Zuviel Leute – zuwenig Leistung.
Nach westlichen Wirtschaftlichkeitsrechnungen ist fast jeder zweite Arbeitsplatz in der UdSSR überflüssig (sie haben also Arbeitslosenrate von 50 %): 25 Millionen Landarbeiter, 16 Millionen Industriearbeiter und jeder zweite Maurer könnten eigentlich zu Hause bleiben (dann würden sie uns erst in 120 Jahren einholen).
Moskaus Wirtschaftsstrategen hätten sich gleich an das alte russische Sprichwort halten (d.h. mit der sprichwörtlichen russischen Faulheit rechnen) sollen: »Mnogo dumajetsja, da ne vsjo to sbudetsja.« – »Vieles ist denkbar, doch nicht alles wird Wirklichkeit«.“ (10./II.4.)
Während Bildleser sich als Deutsche über den Osten aufregen, haben Spiegelleser das nicht nötig. Weil sie es sich hier gut gehen lassen, sind sie so sehr vom hiesigen Staat überzeugt, daß sie es sich auch mal leisten können, sich spielerisch auf den Standpunkt des russischen Staates zu steilen, um ihm eins reinzuwürgen. Mit derselben kritischen Distanz zum russischen Staat, mit der man auch den deutschen bedenkt, kann man sich in ihn reindenken: dann merkt man erst, vor welchen Problemen er steht. Die Erfüllung des Plansolls scheitert stets an der „Undiszipliniertheit und Spontaneität des Sowjetmenschen“ (19/77), so daß „die USA mit weniger Arbeitskräften zweimal mehr als die Sowjetunion produzieren“. Wenn die Russen daher die USA überflügeln wollen, müßten sie sich schon anderer Methoden bedienen, um ihr widerborstiges Volk zu mehr Leistung anzutreiben. Sie wären gut beraten, wenn sie mehr Demokratie wagen würden:
– „Keine streikfähige Gewerkschaft, kein gewählter Betriebsrat, kein unabhängiges Arbeitsgericht steht dem Proletarier bei.“
– „Ein Russe kann seine Familie nur ernähren, wenn die Ehefrau mitarbeitet.“ –
denn nur so können sie die Proleten bei der Stange halten:
„Wenn die Arbeitenden an der Gestaltung der Arbeitsbedingungen nicht beteiligt und von der Bestimmung über das Produkt ausgeschlossen sind, haben sie kein Interesse an der Produktion – sie arbeiten möglichst wenig. Das erklärt den kümmerlichen Lebensstandard – aber es entschuldigt nicht die schwerlich sozialistisch zu bezeichnende Aufteilung der Mittel zu Lasten des kleinen Mannes“, denn „über die Verwendung des Mehrwerts entscheiden allein die 287 (!) ZK-Mitglieder ohne jede öffentliche Diskussion.“
Weil der Spiegelleser diese Lasten nicht zu tragen hat, sondern sich auch „unbescheidene“ Ansprüche erfüllen kann, hat er nicht nur ein Argument gegen die Russen parat, sondern bringt soviel Verständnis für sie auf, ihnen von den verschiedensten Positionen klarzumachen, daß effektivere Arbeit ein Segen für den Staat ist. Ebenso wie er mit den hiesigen Staatsmännern darüber diskutiert, wie sie am besten die Leute bescheißen können und dabei seine Versiertheit in Sachen politischer Rancüne und „Hinter-den-Kulissen“-Details zur Schau stellt, geizt er auch den Russen gegenüber nicht mit kritischen Ratschlägen. Weil er das Geschäft der Politik von einer höheren Warte aus begutachtet, wobei er als Zyniker abgebrüht genug ist, zu wissen, daß Politik ein dreckiges Geschäft ist, gefällt er sich darin, sich ironisch auf die verschiedensten Standpunkte zu begeben, um an den jeweiligen Staaten zu demonstrieren, daß der Spiegel ihnen allemal auf die Schliche kommt und ihnen allen überlegen ist.

Marx, Sowjetstaat und die Russen – jeder gegen jeden
Wenn der Spiegel so sämtliche Standpunkte einnimmt – mit dem russischen Staat gegen die Russen, mit den Idealen der Menschlichkeit, des Sozialismus und der Demokratie gegen den russischen Staat oder auch mit dem westlichen Lebensstandard gegen „König Mangel“ –, um zu beweisen, daß
„die Rückständigkeit am System liegt“ und „Rußland für eine Weltmachtrolle ökonomisch, militärisch und geistig nicht gerüstet ist“, da „die sowjetische Art von Gesellschaftsorganisation nirgends bessere Problemlösungen anbietet“,
so bringt er sein Prinzip zur Meisterschaft, wenn er sich als subtiler Marxkenner ausweist und den Russen ihr Abweichlertum vorhält: Marx hätte aufgrund der „vielen Widersprüche dieses Systems“ diesen „unwissenschaftlichen Sozialismus“ nicht gutheißen können. Und so entdeckt der Spiegel eine Marx-Schrift, die „in den Marx-Engels-Gesamtausgaben der UdSSR und der DDR fehlt“, weil dort „der asiatische Ursprung der Despotie beschrieben“ ist und schlachtet den Begriff Entfremdung, den Marx Korrespondenten zur freien Verfügung anheimstellt:
„Korrespondenten beobachten politische Apathie, Zynismus, Ausnützen aller Lücken, insgesamt einen hohen Grad jener Entfremdung, von der Karl Marx die Menschheit zu erlösen trachtete“,
ebenso aus, wie er der klassischen Revolutionstheorie eine witzig originelle Wendung zu geben weiß:
„Nach dem marxistischen Lehrbuch liefert die UdSSR damit das klassische Terrain für eine Revolution: das pauperisierte Volk müßte (!) sich der gesellschaftlichen Verhältnisse entledigen, weil (!) sie eine weitere Entwicklung der Produktion hemmen. Demnach hätte der Parteiapparat seine eigenen Totengräber herangezogen: ein geschultes (!), ausgebeutetes Proletariat und marxistisch gebildete (!), unzufriedene Intellektuelle.“
Kein Zweifel, wenn sich die Russen, ihrer rückständigen Art von Gesellschaftsorganisation durch Revolution entledigten, der Spiegel würde es im Rückspiegel als Wirkung seines überlegenen Marxismus feiern.
xxxxxxII. Dilettanten im politischen Geschäft undxxxxxx Die roten Totengräber der Demokratie
Nachdem der Spiegel an dieser „stockkonservativen Anti-Konsumgesellschaft“ (19/77) die Überlegenheit westlicher Lebensweise mit Hilfe seiner problembewußten Sichtweise wesentlich differenzierter als die Bildzeitung zu demonstrieren vermochte, wird er bei der Betrachtung der eigenen Nation herausstreichen, daß deren Vorzug gerade in ihrem kritikablen Zustand liegt – weiß man doch hier richtig, d.h demokratisch mit Problemen fertigzuwerden. Die besseren Problemlösungen, die die BRD anzubieten hat, verdankt sie in erster Linie ihrer freien Presse – vorzüglich in Gestalt des Spiegel –, dessen Kritik keine Staatshandlung ungeschoren läßt, sondern als „positive Provokation „die Politiker zum effektiveren Umgang mit der Macht auffordert, wodurch sich die BRD „dem Ideal des Rechtsstaats“ annähern soll. Wie so eine konstruktive Kritik aussieht, führt der Spiegel exemplarisch am Stammheim-Prozeß vor, einem Prozeß „mit Folgeschäden für die Demokratie“ (19/77):
1. war das viele Geld zum Fenster rausgeschmissen, denn
„noch viel mehr Tiefschläge hätte der Rechtsstaat wohl auch dann kaum einstecken können, wäre wirklich kurzer Prozeß gemacht worden.“
2. hat der Rechtsstaat den Prozeß nicht zur Mehrung des eigenen Ansehens genutzt, sondern kriminellen Gewalttätern zur Publizität verholfen:
„Solange sie noch in Freiheit agitierten, blieb die politische Wirkung dieser selbsternannten Revolutionäre gleich Null. Erst aus der Zelle konnten sie den Rechtsstaat herausfordern und verunsichern, weil er sich verunsichern ließ.“
weil ihn 3. lauter Tolpatsche vertraten:
– „In aller Hast hatte das (völlig verschüchterte) Parlament eine Reihe von Gesetzen zusammengeschustert, die für Stammheim entweder zu spät kamen oder derart hingeschludert waren, daß die Richter damit nicht umgehen konnten.“
– Die Beteiligten offenbarten hier ihr „mangelndes Sensorium, kritische Situationen mit Geschick zu meistern,“
sodaß 4. Anlaß zur Sorge um das Ansehen der BRD als Rechtsstaat im In- und Ausland besteht:
– „Das Stuttgarter Unternehmen war mit dem Odium eines Sondergerichts behaftet.“
– „Der Prozeß, so urteilte die »Washington Post« belaste »die demokratischen Traditionen im Deutschland der Nachkriegszeit« und selbst die konservative Neue Zürcher Zeitung sprach vom »Zerrbild eines rechtsstaatlichen Verfahrens«“,
was sich 5. aber das nächste Mal – „die Hydra hat noch viele Köpfe“ – ausbügeln läßt, wenn man den nächsten Prozeß „als Versuch, der Rechtsstaatlichkeit ein wenig näherzukommen“, inszeniert, bei dem durch korrekte Strafverteidigung den Bürger die Gewaltlosigkeit seiner Staatsgewalt anheimelt:
„Wo Strafverteidigung nicht zugelassen oder nur als Feigenblatt getragen wird, waltet eine Gewalt ohne den für ihre (!) Selbstkontrolle und Kontrolle erforderlichen Widerstand, die auch als Staatsgewalt eine Gewalt ist, die gewalttätig werden kann.“
Der harte Vorwurf an die Agenten der Staatsgeschäfte lautet immer, daß sie ihr Metier mangelhaft beherrschen, da ihnen „unangebrachte Scherze“ und „zu groß dimensionierte Worte“ anläßlich des Vietnamkriegs rausrutschen und auch sonst lauter Geschmacklosigkeiten und Ungeschicklichkeiten am laufenden Band passieren und kaum einem von ihnen je gelingt, im richtigen Augenblick zuzuschlagen.
Kollegiales Einverständnis durch kritische Distanz
Die Funktion der „einzig wirklich politischen Zeitschrift in diesem Lande“ besteht also darin, die Qualität der demokratischen Repräsentanten zu demonstrieren dadurch, daß man sie mit allen Mitteln journalistischer Kunst, in der es der Spiegel zu einer eigenen, fortgeschrittenen Abteilung gebracht hat, fertigmacht. So wird einerseits die abgehobene Distanz des Staatsmanns zum Bürger aufgehoben, womit sich andererseits jene Kumpanei herstellt, innerhalb derer das Geschäft des Politikers von demjenigen als Geschäft taxiert wird, der durch seinen Erfolg in der Konkurrenz bewiesen hat, daß auch er weiß, worauf es beim Geschäftemachen ankommt: so erhalten Staatsleute zwischen Vor- und Zunamen in Klammern einen Spitznamen beigefügt, den notfalls die Redaktion erfindet, womit ihnen die Weihen des Amtes entzogen werden, die es bei der schlitzohrigen Kumpanei nicht braucht, und nur noch das Amt und der Mann übrigbleiben. Bilder von Politikern zeigen diese prinzipiell in ungünstigster Optik und die Zeile unterm Bild soll durch das Bild konterkariert werden. Weil die Politiker wissen, daß die Häme des Spiegelstils keiner Feindschaft des Nachrichtenmagazins gegen die Politik entspringt, sondern dem Bedürfnis seiner gehobenen Leserschaft entgegenkommt, im Politiker die verwandte Charaktermaske zu erkennen, stellen sich selbst Staatsmänner, gegen die der Spiegel Kampagnen führt, wie F.J. Strauß, dem „Spiegel-Gespräch“, das sie gerade dadurch aufbaut, daß sie es sich leisten, auch einmal schlecht auszusehen. Bei aller Erbitterung, die Politiker bisweilen zu Prozessen mit dem Spiegel veranlaßt, bestätigen ihm selbst seine ärgsten Feinde die „demokratische Kontrollfunktion“, die er ausübt. Diese besteht in der Besprechung der Auswirkungen aller Staatshandlungen bezüglich der Glaubwürdigkeit des Staates beim einfachen Volk, das sich im Gegensatz zur Spiegel-Elite immer noch Illusionen macht über das harte Geschäft des Staatsmanns, und wird immer dann besonders extensiv ausgeübt, wenn der Spiegel die Grundlage seines Geschäfts angetastet sieht: die Spiegel-Affäre war so tatsächlich eine Affäre des Spiegel mit der Staatsgewalt und auf Wanzen u.a. reagiert er allergisch, weil er fürchtet, sie könnten auch mal im Hamburger Spiegelhaus angebracht werden.
Seine Leser und er selbst blicken mit Verachtung auf Bild und die 6 Millionen Deutschen, die solches niveauloses Zeug lesen und wollen doch an dieser demokratischen Institution nicht kratzen, weil sie sich in ihr ihre Überlegenheit täglich bestätigen können (weswegen sie sie auch ab und an mal lesen). So beweist die Beschimpfung des Bildvolkes als „unpolitisch“ und „niveaulos“ den eigenen Status einer politischen Elite und zugleich die Zufriedenheit darüber, daß es viele Menschen gibt, die sich umstandslos mit dem Staat einverstanden erklären.
Rote Köpfe müssen rollen
Dies ist die Leistung des einfachen Mannes, der auf seinen Staat nichts kommen läßt, obwohl er Gründe zur Unzufriedenheit hat, und dessen politisiertes Bewußtsein darin besteht, diese Gründe in Bestätigungen seines Staatsglaubens zu verwandeln.
Alle Demokraten können daher froh sein, daß es die Bildzeitung gibt, die erkannt hat, welchen Schaden es anrichten würde, wenn sich ihre Leser, die andere Sorgen haben, den Kopf über die Effektivierung der Demokratie zerbrechen würden, und ihr faschistisches Bewußtsein stärkt, in ihrer Aufopferung für den Staat eine zu begrüßende Selbstverständlichkeit zu sehen. Deshalb tastet diese Zeitung auch die Unzufriedenheit nicht an, sondern unterstellt sie als selbstverständliches Bedürfnis, was selbstverständliches Bedürfnis unterstellt, was sie stillt, indem sie als deren Grund Schuldige nennt – so daß die Politiker unbehindert die Geschäfte der Demokratie besorgen können. So affirmiert Bild die Unzufriedenheit ihrer Leser, indem sie für sie eine Partei verantwortlich macht, die sich auf Kosten der Steuerzahler ein schönes Leben macht:
„SPD-Führer damals und heute
Damals: Abgewetzter Mantel und Baskenmütze waren das weltweite Erkennungszeichen des bescheidenen Berliner Bürgermeisters Ernst Reuter und seiner Frau Hanna – beides aufrechte Demokraten.
Heute: Die sozialdemokratische Führung liebt es prunkvoller.“ (29.5. 77),
so korrupt ist, an Rücktritt nicht zu denken:
„Hut ab, ohne rot zu werden
Sehr schlimm war es nicht, was sich das Ehepaar Rabin vorzuwerfen hatte: ein Auslandskonto (das hat doch hier jeder Arbeiter), redlich (das muß man betonen) erworbenen Geldes aus ihrer Amerika-Zeit. Aber Israels Gesetze erlauben das nicht. Frau Rabin zahlte eine hohe Geldstrafe (eine Buße, die für einen so sauberen Politiker wie Rabin völlig ausgereicht hätte) und ihr Mann trat zurück (um deutschen Sozialdemokraten ein Beispiel zu geben) – klar und sauber.
Hut ab. Und bei uns? Hut wieder auf! In Hessen blubbern die Sumpfblasen nach Albert Osswalds viel zu spätem Rücktritt.
Krumme Dinger. Dreck kommt unter den Teppich. Weiße Westen bleiben Mangelware – nicht mal die Köpfe werden rot.“ (18.4. 77)
und dabei den Führer der Partei ruiniert:
„Des Kanzlers Bürde
Viel ist nicht mehr von der vielbeschworenen Solidarität der Genossen übrig. Den Schaden haben die Bürger, wenn der beste Mann kaputtgemacht wird, den die Partei noch hat.“ (4.5. 77)
Ist für Bild der Zustand der SPD Material, für die CDU und darin vor allem für den rechen Flügel und die CSU zu agitieren, so füllt der Spiegel seine Spalten mit der ironischen Kommentierung der Dilemmata einer Reformerpartei, die an der Macht mit den Idealen des demokratischen Sozialismus ständig Schwierigkeiten hat, was sich im internen Zwist der Parteiflügel niederschlägt. Ist für Bild die Korruption der Politiker das Thema, so registriert der Spiegel genüßlich die Korrumpierung der SPD-Politik und erteilt hierzu Leuten wie Jochen Steffen das Wort, die für Bild Staatsfeinde im SPD-Gewand sind. Für den Spiegel-Leser, dessen „Aufgeklärtheit“ darin besteht, sich keine Illusionen über die Prinzipientreue der Politiker zu machen, folglich auch in Helmut Schmidt das Prinzip des Pragmatismus verkörpert sieht, auf den es bei den Staatsgeschäften ankommt, desavouiert ein Albert Osswald die SPD mitnichten: schadenfroh entnimmt er dem Magazin die Enthüllung der Geschäftspraktiken dieses Staatsmanns und fühlt sich in seinem kritischen Verständnis des Staatsgeschäfts bestätigt. Skandale gehören zur Politik, und die einzig interessante Frage ist, ob es den betroffenen Politikern gelingt, sich trotz der Spiegelstänkereien zu halten oder ob sie das Handtuch schmeißen müssen.
Sind im Weltbild des Bildlesers für jede Sauerei im Staat die Sozis verantwortlich, so weiß er auch, wer ihm das Fernsehprogramm vermiest: die ewigen Stänkerer in den Rundfunkanstalten vergiften die Jugend und sind schuld daran, daß es immer wieder Leute gibt, die das eigene Nest beschmutzen:
| „Freiheit, die sie meinen Wir, die Gebührenzahler, sind es Ja gewohnt: Marxistische und radikalsozialistische Rundfunkredakteure betrachten die Sendeanstalten als ihre Privatsender. Sie schmuggeln einseitige Kommentare, Hetze, Propaganda, Demokratie-Beschimpfung in einem unerträglichen Ausmaß ins Programm. Das ist die Freiheit, die sich westdeutsche Funkredakteure auf unsere Kosten nehmen: Die Gesetze der täglich beschimpften Bundesrepublik ausnutzen, um uns die Unfreiheiten des Osten? (die sie selbst scheuen, denn sie bleiben ja hier!) propagandistisch schmackhaft zu machen.“ (8.5. 77). |
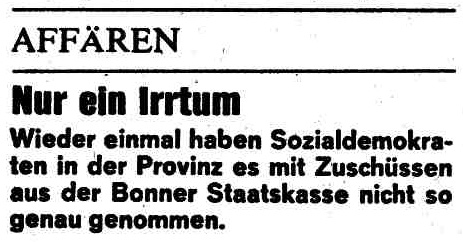 |
Ein Schlaraffenland für Terroristen?
Für die Terroristen sind nicht deren Eltern verantwortlich:
„Geschlagene Eltern
Die Buback-Mörder? Drei Söhne aus gutem Haus ..., schrieb Bild gestern. Der eine musikalisch, der andere tierlieb, der dritte ein Pfadfinder ... Was können die Väter und Mütter dieser Kinder für diese Kinder, wie sie heute sind?
Nichts. Es ist nicht ihre Schuld. Wer hat Schuld? Falsche Freunde? Falsche Vorbilder? Die Straße? Die Uni?
Wer Kinder hat, fühlt mit den geschlagenen Eltern. Ja, auch sie sind Opfer.“ (13.4. 77),
für den Tod der Polizisten nicht die Terroristen, sondern die SPD:
„Die Polizisten von Singen – Opfer einer falschen Erziehung
Wie war es möglich, daß ein wenn auch junger Kripobeamter und ein Hauptwachtmeister auf den plumpesten aller Tricks hereinfielen, indem die Ganoven vorgaben, ihre Ausweise lägen in ihrem Auto, das es gar nicht gab?
Die beiden Polizisten sind nicht Opfer der Gangster geworden, sie waren Opfer einer falschen Erziehung die aus ihnen nicht Beschützer der Bürger, sondern Sozialhelfer für Gestrauchelte machen wollte.“ (8.5. 77),
die ihren Genossen auch in der Zelle ein Luxusleben bietet, während Vera Brühne immer noch revisionslos beim Tütenkleben dahinhärmt. Aufgrund ihrer Skrupel bei der Gewaltausübung des Staates sind solche Terroristenfreunde nicht länger tragbar:
„Ein Tag im Leben des Terroristen Baader:
Behutsam weckt der Gong die Schlafenden: »Ding-Dong«. Kurz danach wird an die Tür geklopft: »Guten Morgen!« Dann fährt der Frühstückswagen vor: Frische Semmeln, Vollkornbrot, Weißbrot und Kuchen zur Auswahl, Schinkenwurst, Salami und Käse, dazu Buttersternchen – in Eiswasser gekühlt. Diesen Service genießen Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Jan-Karl Raspe im Gefängnis Stuttgart-Stammheim.
6.30 Uhr: Frühstück. Gudrun Ensslin kommt mit ungekämmten Haaren aus der Zelle. Wortlos zeigt sie auf Semmeln und Wurst. Die Wärterin legt ihr wie gewünscht mit einer Servierzange alles auf einen weißen Porzellanteller...
8 Uhr: Baader drückt auf einen Knopf und verlangt über die Sprechanlage vom Wachhabenden: »Ich will mit den anderen reden!« ... Vier Stunden täglich dürfen sie sich unkontrolliert unterhalten ...
11.30 Uhr: Mittagessen in Portionsschüsseln von Wärmeplatten: Fleischbrühe, Rostbraten (seit dem Hungerstreik eine Portion zusätzlich), Kartoffeln, grüne Bohnen...
20 Uhr: Irmgard Möller und Ingrid Schubert dürfen die Nacht bei Gudrun Ensslin verbringen. Sie sehen die »Tagesschau« (jeder hat einen eigenen Fernsehapparat). 23 Uhr: Der Strom wird abgeschaltet. Gute Nacht, Genossen! Gute Nacht, Vater Staat!“ (16.5. 77)
IV. Sinnvolle Verbrechensverhütung und die legale Rache des kleinen Mannes
Mit Artikeln über „Terroristen“ und „normale Gangster“ will Bild jedoch nicht nur darauf drängen, daß sie endlich einer gerechteren Strafe unterzogen werden, sondern an ihren Abartigkeiten (die in jedem von uns schlummern) demonstrieren, daß sie zu ihrer Zügelung des Staates bedürfen – weshalb man dieser Beschützerin der Bürger dankbar zu sein hat:
„Ists Glück, wenn nichts geschieht?
Und immer – ob beim Mord, Selbstmord oder Massentod – kommt bei uns selbst sofort die Frage: Wenn mir das passiert wäre?
Natürlich kann einem bei diesen Schicksalsschlägen sofort (?) der alte Aristoteles einfallen, der sagte, Glück sei, wenn den Nebenmann der Pfeil trifft. Und wahrscheinlich ist unsere Fähigkeit, immer und überall von neuem mitzuleiden, wenn eine solche Nachricht kommt, irgendwie begrenzt. Ja nach einer Phase ohne solche Teneriffa-, Barzel-, Buback-Meldungen kann man sich sogar denken, daß Glück heute schon bedeuten könnte, wenn nichts geschieht –- so bescheiden kann der Mensch werden. Die Bedrohung des Lebens (!) zu jedem Augenblick an jedem Ort in jeder Form beweist uns schmerzhaft, daß nicht alles so ist, wie wir (!) es am liebsten haben: meßbar und machbar.
Und so gesehen werden die Schreckensnachrichten ... indirekt für uns selbst wirksam: Denn indem wir wieder unsere Verwundbarkeit spüren, werden wir, ob wir wollen oder nicht (!), demütiger und menschlicher.“ (17.4. 77)
Die ständigen Entbehrungen, die die Menschheit zu erdulden hat, sind also immer noch besser als sterben zu müssen und denkt sie sich die Existenz des Staates weg, so daß pausenlos Mord und Totschlag, Selbstmord und Massentod geschehen, wird sie vollends bescheiden und wünscht ihn sich sofort in aller Demut möglichst gewalttätig zurück, um die Bedrohung des Lebens zu beenden. Der Unfähigkeit mitzuleiden, hüft Bild im übrigen durch tägliche Interviews mit Frau Buback ab, und daß das aufopfernde Geschäft der staatlichen Gewaltausübung nicht nur den Dank der Bürger verdient, sondern ihrer entschlossenen Mithilfe bedarf, ruft sie lahmen Omas und Opas z.B. so zu:
„Wo seid ihr denn, Omas und Opas? Ich rufe euch zur Selbsthilfe auf! Ihr wißt doch nicht immer, was ihr mit eurer Zeit anfangen sollt. Opas und Omas, tut euch zusammen! Bewacht die Spielplätze, laßt Kinder nicht allein spielen. Sagt nicht, Kinder sind mir zu laut. Ihr seid selber einmal Kinder gewesen. Steckt eine Trillerpfeife ein. Ihr Ton verjagt jeden Verbrecher.“ (zit. nach IV, 47)
Der Mord, von dem man träumt
Wenn Verbrechern stets der Prozeß gemacht wird, dann befriedigt Bild nicht die heimlichen Wünsche ihrer Leser:
„Wenn unsere privaten Verhältnisse die sind, von denen wir lesen, dann ist der Mord, der da gemeldet wird, der, von dem wir (!) träumen.“ (IV, 60),
sondern lehrt sie, daß Verbrechen sich nicht lohnt, und ein braver Bürger die Gesetze respektiert, auch wenn's ihn hart ankommt. Um das gesunde Rechtsempfinden zu schärfen und Gefahren von den Bürgern abzuwenden, die mit unkontrollierten Verhaltensweisen Verbrechen gegen sich geradezu herausfordern, unterscheidet sie zwischen völlig unschuldigen Opfern und solchen, denen es recht geschieht.
So kann der „bis zur Tat unbescholtene“ Dr. dent. sich von Bild bestätigen lassen, daß ihn letztlich die sozialdemokratischen Liberalisierungen des Strafrechts zur Verzweiflungstat getrieben haben, als deren Folge Ehebruch nicht mehr strafverfolgt wird. Sollte die Frau jedoch das Glück haben, die Aufmerksamkeit des Spiegel-Justizreporters Mauz zu erregen, so darf sie seiner Sympathie sicher sein. Dieser Moralist der modernen Moral kann am Fremdgehen nichts Anstößiges finden, entspricht es doch durchaus den psychologisch angeratenen Formen moderner Partnerschaftsehen, und war es nicht mit Sicherheit der verständnislose Gatte, der auch nachts nur Plomben im Kopf hatte, der seine Frau zur „sexuellen Kommunikation“ mit Dritten trieb? Während für Bild die ausführliche Berichterstattung über Verbrechen aller Art dazu dient, die Moral seiner Leser dadurch zu bekräftigen, daß sie ihre Saubermann- und „Ordnung-muß-sein“-Prinzipien mit der Rechtspraxis vergleicht, und dazu eignet sich der Fall bestens (Frau war untreu, das hat sie davon. Mann hat auf Untreue mit Mord reagiert, kommt ins Zuchthaus, muß sein, weil etwas zu weit gegangen), nimmt der Spiegel die Diskussion über die prozessuale Würdigung ausgesuchter Untaten her, um die Tragfähigkeit der Moral kritisch zu untersuchen. Weil Verbrecher machen, was der Bürger auch gerne möchte, aber nicht macht, sind sie nie ganz schuldig, und das Hauptproblem von Mauz besteht darin, die Straftat als Konflikt des Täters mit der Umwelt zu diskutieren, worin sich jene immer auch schuldig macht, weil sie den moralischen Konflikt des Täters verursacht hat. Für Bild hingegen sind Verbrecher Verbrecher und der 15jährige Hubert B. kann nur deshalb mit Verständnis rechnen, weil er ins verkehrte Gefängnis gesteckt wurde und jugendliche Reue zeigt.
„Die zwei Höllen des Hubert B.
Er war 15 Jahre alt, als er einen Stein auf die Autobahn warf. Es sollte ein Dummerjungenstreich sein. Aber eine Frau wurde getötet.
Hubert B. ist durch die Hölle gegangen – durch eine innere, die er noch nicht hinter sich gelassen hat. Und durch eine äußere – er hat 22 Monate im Untersuchungsgefängnis gesessen. Unter Mördern, Triebtätern, Dieben und Fälschern.“ (29.5. 77)
Kriminalpolitisch sinnlos
Der Spiegel hingegen macht aus den Verbrechern Opfer der Gesellschaft:
„Wir haben es nie geschafft: Jürgen Bartsch ist ein Opfer ...“ (G. Mauz),
womit er jedoch nicht für Abschaffung der Strafjustiz plädiert, sondern den Gerichten durch die sozialförderliche möglichst frühzeitige Anpassung, die die Opfer nicht zu Verbrechern werden läßt, Arbeit abnehmen will:
„Verbrechensverhütung, die tief genug ansetzt, darf sich nicht darauf beschränken, nur die vom jeweils geltenden Strafrecht verbotenen Handlungen zu verhindern; sie muß vielmehr darauf ausgehen, sozialschädliche Neigungen in den Menschen gar nicht erst entstehen zu lassen.“ (ebd.)
Der Spiegel freut sich also über den zivilen Charakter der Gewalt, was er in die Sorge um ihre Effektivierung kleidet:
„Mangelhafte Ausrüstung der Scharfschützen
Kein Zweifel wohl: Wenn Scharfschützen schon notwendig sind, gebührt ihnen die beste Ausrüstung. Doch ...“ (21/77)
„Empfehlenswert: Kindergarten statt Vorschule
Der Kindergarten, einst von Bildungsreformern (!) abqualifiziert, erweist sich als erziehungstüchtiger als die hochgelobte Vorschulerziehung.“ (20/77) –
was nicht heißt, daß man mit der Nützlichkeit des bestehenden Gewaltapparates unzufrieden wäre:
„Todesstrafe: Jeder zweite ist dafür
Die Todesstrafe, kriminalpolitisch (?) sinnlos (!) und laut Grundgesetz abgeschafft, findet immer mehr Befürworter – Angstreaktion der Deutschen, konservativer (!) Klimasturz?
Wie aus rätselvollen Tiefen geschöpft (!) wirkt die Zuversicht, mit der die Befürworter in fast schon komischem (!) Eifer stets aufs neue gegen die Tatsachen anrennen: Die Todesstrafe in der BRD wird es nämlich (wie aus gut unterrichteten Kreisen verlautet) trotz allem nicht geben.“ (19/77)
Ja, der Spiegel ist sich dessen und seiner Lesern die diesen Klimasturz nicht verursachen, so sicher, daß er sich über das kriminalpolitisch ungebildete Volk, das die Überflüssigkeit von Henkern nicht begreifen will, lustig macht, obwohl ihm nicht nur sein Blick zurück oder nach Amerika zeigen könnte, daß Politiker einem Volk nicht widerstehen können, das sich den Staat so stark wie möglich wünscht.
Der letzte deutsche Henker
Bild kann sich dieser ironischen Raisoniererei, die selbst dem „Kopf-ab“-Geschrei noch Komik abgewinnt, nicht anschließen: die Unzufriedenheit seiner Leser mit dem Grad an Härte, der Gesetzesbrecher trifft, kann nur allzuleicht in den Wunsch umschlagen, gegen das Gesetz die Züchtigung der Täter selbst vorzunehmen – und was passiert, wenn „ein Mann rotsieht“ läßt sich zwar im Film exemplarisch vorführen, wo ein Charles Bronson mit dem Feindbild des Bildlesers kurzen Prozeß macht, muß aber im Staate dessen Gewalt vorbehalten bleiben. So werden einerseits der Haß des Bürgers und seine Rachegefühle dem Verbrecher gegenüber angeheizt, andererseits distanziert sich Bild in perfider Heuchelei vom Fallbeil. Daß die Gegnerschaft Axel Springers zur Todesstrafe nicht irgendwelchen Zimperlichkeiten dem Verbrechen gegenüber sich verdankt, sondern durchaus staatsmännischen Überlegungen, macht eine Bildserie deutlich, in der das Problem der Todesstrafe aus der Sicht des Henkers ausgemalt wird, wodurch die Lust am Töten und die Notwendigkeit seiner Beschränkung aufs für den Staat Notwendige gleichzeitig sich bestärken lassen: „Bild fand den letzten deutschen Henker – lesen Sie seine Lebensbeichte Bild zeigt, daß es die Todesstrafe in Deutschland nicht geben darf, weil der Tod auch ganz junge und ziemlich unschuldige, manchmal sogar wertvolle Menschen treffen könnte, weil nur die Nazis so feige Menschen sind, daß man sie hängen muß: „Die waren richtig feige. Die kamen schon und waren am Zittern und Heulen. Es ist keiner mit dem Gruß »Heil Hitler« gestorben“, |
 |
weil sich unter den Deutschen nicht noch ein Zweiter wie dieser atheistische („Ich hab keinen zurückkommen sehen“) Henker finden sollte, der eigentlich von Beruf Metzger und daher auch bei der Ausübung seines Handwerks kein Gefühl empfand.
Der Faschist im Bürger, der am liebsten selber zuschlagen würde, wird dadurch demokratisch domestiziert, daß er seinen Wunsch nach Rache vom Staat exekutieren läßt und ihn somit legal befriedigt. Dieser Appell an die Deutschen, ihren Hang zur Grausamkeit in die zivilen Formen staatlicher Gewalt einzubringen, bedarf einer faschistischen Agitation, die den Gegensatz zwischen Staat und Bürgern nicht durch Problematisierung harmonisiert, sondern dessen Existenz verherrlicht, so daß die Bürger stolz ihre Opfer bringen, um die Stärke der Nation zu mehren. Da Bildleser die Gewalt nicht nur über sich ergehen lassen, sondern positiv zu ihr stehen und damit sich selbst Gewalt antun, um sich in ihrer Bescheidenheit als nützliche Deutsche auszuweisen, verstehen sie ihre Selbstbeherrschung zum Wohle der Allgemeinheit nicht als Opfer, sondern als die schönste Sache von der Welt, in der es nur wenige zur Perfektion bringen. Und weil es zur Aufrechterhaltung der Gewalt des Staates darauf ankommt, daß die Bürger sie für etwas Feines halten und in ihren Opfern nur die eigene Leistung sehen, braucht Bild nichts anderes zu tun, als in jedem Artikel diese Auffassung ihrer Leser zu bekräftigen.
V. Konjunkturlage und Arbeitsmannes Lust und Leid
An der Geschichte des 31jährigen Albert Hörndl etwa, den der Einberufungsbefehl in die Agoraphobie trieb:
„Angst! Dieser Münchner traut sich seit zehn Jahren nicht auf die Straße
Er könnte leben wie ein ganz normaler junger Mann – könnte im Englischen Garten spazierengehen, sich amüsieren.
Aber er lebt wie ein Gefangener – mitten in Schwabing.
Es begann Im April 1966 – Einberufung zur Bundeswehr. Davor hatte der dunkelhaarige 1,85 Meter große Mann Angst.
Daß es gestern geschneit hat, in München, hat Albert Hörndl nicht bemerkt»
Wenn er aus dem Fenster schaut, klappt er zusammen ...
Freiheit bedeutet für ihn Angst: Albert Hörndl (31).“ (13.4. 77)
läßt sich der Leser die Normalität seiner eigenen Lebenstüchtigkeit vor Augen führen, die mit den Unannehmlichkeiten des Militärdienstes fertigwird, weil man eine Armee zur Verteidigung der Freiheit braucht – und man sich durch Zusammenklappen angesichts staatlicher Gewalt die Chance vermasselt, die amüsanteren Seiten des Lebens in Freiheit zu genießen.
Daß „Leben“sangst grundlos ist, weiß der Bildleser, weil ihm überall Menschen mit Trost und Rat zur Seite stehen, wenn er sie braucht. Und so würden sie auch „Ackermännchen“ Albert Hörndl wieder auf Vordermann bringen, wenn er sich aus seiner freiwilligen Gefangenschaft entlassen könnte:
Bildlicher Trost
„»Ackermännchen« – die Mutter des Bataillons
Seit 20 Jahren steht die dienstälteste Kantinenwirtin an der Thekenfront der Soldaten in Andernach; am Bierhahn, an der Schnitzelpfanne und am Wurstkessel. Liesel Ackermann (55) weiß von »innerer Führung« mehr als so mancher Offizier.
Wenn's notwendig ist, liefert, »Ackermännchen« mütterlichen Trost und Rat kostenlos dazu: Einem Obergefreiten aus Köln, dem zwischen Weihnachten und Silvester die Verlobte davongelaufen war, spendierte sie zur Aufmunterung eine Flasche Sekt... Auch den Soldaten, die Ärger mit dem Spieß oder dem Kompaniechef haben, hilft sie gern. Wenn sich »die Jungs« bei ihr ausgeweint haben, ruft Liesel Ackermann oft beim Vorgesetzten an und vermittelt: »Der Junge will sich bessern. Der meint's doch gar nicht so.«“ (1.5. 77)
An Ackermännchen hat man also nicht nur seine Freude, weil man selbst seinen Mann steht, sondern weil es einem nicht immer so vorbildhaft mütterlich gelingt wie ihr. Und weil der Bildleser sich bessern will, bestätigt er sich an der Geschichte des Rudi Maier, der ein Schicksal, vor dem das eigene farblos erscheint, nicht nur gemeistert hat, sondern mit ihm glücklich geworden ist, die Kleinlichkeit unzufriedenen Murrens:
„Das Erstaunliche am neuen Leben des Olympiafechters Rudi Maier
An den Rollstuhl gefesselt, aber glücklich. Er kann sich nicht mehr bewegen und hat trotzdem gelernt, sein Schicksal zu bemeistern. »Wenn ich die Arbeit nicht hätte, würde mir viel fehlen. Sie hat mir neuen Halt gegeben.«, sagt Rudi Maier.“ (11.4. 77)
und richtet sich an der Selbstlosigkeit der Tiere auf, die ihr Leben lang treu gedient haben und im Sterben nur zweimal kurz aufwiehern:
„Gestern wieherte das Kutschpferd »Adel« (16?) des Hamburger Jacob Macowe (35) zweimal kurz auf. Dann brach es zusammen und starb.“ (7.1. 77)

Millionen danken Erhard!
Die Bildzeitung, die das Einverständnis ihrer Leser mit der Staatsgewalt voraussetzen kann, agitiert für deren Opfer nicht nur an denen, die an der Gewalt kaputtgehen oder denen, die sie an sich bemeistern, sondern auch an jenen, die die Gewalt ausüben – denn Politiker sind die Wohltäter der Menschheit:
„Dankeschön, Ludwig Erhard
Wir kennen den Hunger nicht mehr, die Angst vor der Not am Abend des Lebens.
Wir sind Bürger eines Staates, der (!) in Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit seine Ideale hat. Ein Bürger dieses Staates ist gestern zu Grabe getragen worden: Ludwig Erhard.
Es war sein kühner Mut, in Ruinen, in Not und Elend geboren, der uns Deutschen das Leben wieder lebenswert machte.
Dankeschön, Ludwig Erhard.“ (12.5. 77)
Sein braves Dankeschön entrichtet der Bildleser also an die Politiker, weil sie ihn mit ihren Idealen zu einem zivilisierten Menschen gemacht haben und obendrein sich mit ihrer ganzen Kraft für das Florieren der Wirtschaft einsetzen, von der er nur Vorteile hat:
„Die Hausfrau freut sich
Die dümmsten Bauern haben die verfaultesten Kartoffeln
Als die Preise in den Himmel schossen, haben sie nicht verkauft. Sie wollten noch höhere Preise. Jetzt müssen sie verkaufen. Mit Verlust.
So ist das in der Marktwirtschaft, bei freien Preisen. Mal geht es rauf, mal wieder runter. Zum Schluß profitiert die Hausfrau.“ (5.5. 77),
weil er ihre Regeln so gut beherrscht, daß er den Großen bereits Nachhilfe erteilen kann:
„Nachhilfe in Marktwirtschaft
Dreimal haben sie’s versucht. Esso und Shell, BP und Aral wollten uns teureres Benzin verkaufen. Dreimal sind sie hinten am Kofferraum wieder runtergerutscht. Die Autofahrer haben die höheren Preise nicht angenommen. Benzin wird wieder billiger. Das ist eben Marktwirtschaft.
Nicht ein paar Große haben das Kommando. Sondern Millionen Kleine.“ (10.5. 77)
Arbeitslust verscheucht das Streikgespenst
Und weil die Bildleser alles tun, damit die „900 000 000 000 DM“ , die „auf unseren Bankkonten schlummern“ (1.5. 77), sich vermehren, kann Bild heute darauf verzichten, ihnen mit dem „Streikgespenst“ zu drohen:
„Setzt Euch an einen Tisch!
Das Streikgespenst bedroht unser Wirtschaftswunder. Darum: Hört auf mit dem Streikgerede! Setzt Euch erneut an einen Tisch und steht nicht eher auf, bis Ihr Euch geeinigt habt! Zum Wohle aller!“ (9.2.77),
und sich darauf beschränken, beim Schah die Bedingungen seiner Investitionsbereitschaft zu erkunden:
„Bild am Sonntag: Was muß Deutschland tun, um mehr iranische Investitionen zu erhalten?
Schah? VW ist O.K.“ (8.5.77)
der Regierung schleuniges Handeln in Sachen Jugendarbeitslosigkeit zu empfehlen, da diese Jugendlichen ihre Hilfe verdienen:
„Von den 28 Schülern der 9c sind 21 noch ohne Lehrstelle. »Eine Katastrophe«, sagt der Klassenlehrer. »Das sind alles brave Jungen, die arbeiten wollen. Ich kann verstehen, wenn sie langsam den Mut verlieren.«“ (7.5. 77)
Der Vorwurf an den Staat, er sei nicht im Stande, wertvolles Menschenmaterial bei der Arbeit einzusetzen – der Bildleser, der hier sofort an Hitlers Autobahnprogramm denkt, weiß diesen Vorwurf zu würdigen –, paart sich mit der Beschimpfung der Arbeitslosen, deren latenter Hang zur Faulheit sich hier mit Hilfe des Stempelgeldes schmarotzerhaft auslebe, womit auch die andere Seite des faschistischen Bewußtseins zu ihrem Recht kommt, die sich nach Hitlers Arbeitslagern sehnt. Daß ein solches Leben auf der faulen Haut keines ist, macht Bild deutlich in einer Serie, woraus man lernt, daß in der Fabrik nicht nur geschuftet wird, sondern daß sie vielmehr der Ort „schönster Erlebnisse“ ist:
„Mein schönstes Erlebnis am Arbeitsplatz
Wir verbringen mindestens ein Drittel unseres Lebens am Arbeitsplatz. So ein Arbeitstag, was ist das eigentlich? Acht Stunden im Büro, in der Fabrik, im Kaufhaus – Routine, Alltagstrott?
Sicherlich nicht! Wahrscheinlich hatten auch Sie an Ihrem Arbeitsplatz SCHÖNE ERLEBNISSE – mit Kollegen, mit dem Chef.
Vielleicht ist Ihr Vorgesetzter besonders nett zu Ihnen, wenn er weiß, daß Sie Probleme haben. Vielleicht ...“ (3.5. 77)
Stagflation und Anspruchsdenken
Wenn so die, die die Last der Arbeit zu tragen haben, mit Bild sich zu „ihrer“ Wirtschaft gratulieren, hat der Spiegel das Problem der Arbeitslosen längst in ein wirtschaftstheoretisches verwandelt. Dazu wird erstmal denjenigen, die bisher fürs Arbeiten anständig bezahlt worden sind, Verständnis entgegengebracht:
„Im öffentlichen Dienst und in der Wirtschaft sind wohldotierte Posten rar geworden – aber die Ansprüche der angehenden Akademiker sind geblieben ... Sicherlich scheinen 580 Mark Bafög Höchstförderung nicht eben wenig angesichts allgemeiner Arbeitslosigkeit, aber...“ (Spiegel 21/77),
womit jene freilich nicht rechnen können, die primitives „Anspruchsdenken“ soweit gebracht hat, auch noch als Arbeitslose den Staat auszubeuten:
„In der Tat? Vom Stempelgeld läßt sich leben.“ (ebd.)
weil sie, arbeitsscheu wie sie sind, „wählerischer“ geworden sind:
„Und von denen, die sich in den Betrieben melden, lehnten die meisten eine Anstellung ab, weil ihnen die Bezahlung zu schlecht schien oder die Arbeit zu schwer und zu schmutzig.“ (ebda.)
Die Arbeitslosigkeit so zum ausschließlichen Problem der Opfer gemacht, kann man sie auch vergessen und den Gang der Wirtschaft begutachten:
„Konjunktur läuft nicht richtig.“ (19/77)
Auf dieser höheren Ebene läßt sich mit intimen Keyneskenntnissen prunken, in Essays die „Stagflation“ als das Problem moderner Wirtschaft erfinden und selbst der alte Marx darauf abklopfen, ob er originelle Vorschläge zum Ankurbeln der Konjunktur zu machen hat. Weil „das starke Interesse der Spiegelleser an Wirtschaft“ ihrem Interesse entspringt, das befriedigt werden will, münden solche Betrachtungen stets in die Aufforderung an den Staat, seine Mittel noch effektiver zum Funktionieren der Wirtschaft einzusetzen.
V. Pikante Pornographien und vorbildliche Geschichten aus dem Liebesalltag
Während sich so beide Zeitungen für Wirtschaft und Staat stark machen, muß die Bildzeitung, die bei der Agitation gegen die Ansprüche der arbeitenden Wirtschaftssubjekte und der Mehrheit der Staatsbürger ihren Lesern für die tägliche Schufterei nichts als Opfer verheißt, dafür sorgen, daß sie diese auch freudig bringen. Was den Arbeitsmann fit halten soll für seinen eigentlichen Wirkungsbereich, die Familie, ist ihm jedoch zusätzliche Belastung. Während der Spiegelleser, dem die Familie Sexualpartnerschaft und Freizeitvergnügen ist, welches beides er sich als moderner Zeitgenosse auch mal außerhalb holen kann, ohne deshalb gleich die Familie zu zerstören, vor allem dann nicht, wenn auch die Gattin Spiegelleserin ist und um die erfrischende Funktion von Seitensprüngen weiß, durchaus aufgeschlossen allen Experimenten gegenübersteht und mit Peter Brügge gerne in einer Kommune zu Gast weilt, läßt Bild auf die Familie nichts kommen und bestärkt ihre Leser darin, es mit allen Frusts in ihr auszuhalten. Dies geschieht in der Form der Unterhaltung, die mannigfaltige Geschichten aus dem Alltag des bürgerlichen Heldenlebens bietet. Im Sprachstil des Erlebnisaufsatzes werden exemplarische Geschichten aufbereitet, deren Exemplarität gerade darin besteht, daß das dem Leser vertraute Normale ins Extrem übersteigert und er gerade dadurch zur lehrreichen Identifikation befähigt wird. Die Moral solcher Erzählungen ergibt sich durchs Wegstreichen aller Umstände, die das Anormale provoziert haben: wenn ein Mann seine Frau erschlägt, weil sie jede Nacht schnarcht, wobei Bildreporter anscheinend vor der Tat mit dem Mikrophon im Schlafzimmer präsent waren – so genau die Beschreibung der Schnarchtonvariationen des Opfers –, so ist die extreme Konsequenz, die solche jedermann bekannte ehegefährdende Unart nach sich zog, zugleich die Versicherung, daß Schnarchen auch einfacher abgestellt werden kann und soll.
Die deutsche Mutter: einmalig
Auf die Familie darf man also nichts kommen lassen –
„So naiv es klingt: Jede Mutter gibt es nur einmal“ (21.4. 77)
und so startet Bild ihre unterhaltsame Agitation für die Keimzelle des Staates mit einer Serie „über die unbekannten Mütter der bekanntesten Deutschen
„Genschers Mutter – und Ihre Mutter?
Wenn Sie durch den Bericht über die Mutter vom Außenminister Genscher wieder einmal an Ihre eigene Mutter denken – hat Bild schon etwas erreicht.“ (18.4. 77)
Und weil es den Muttertag gibt, weil „das für manche Mutti der einzige Tag im Jahr ist, der ihr ganz allein gehört“, wird er von Bild mit „Liebesbriefen an die Mutter“ gefeiert, die die „lieben Kinder“ an Bild schicken:
„Liebe Kinder,
nur noch vier Tage – dann ist Muttertag. Für Euch Ist es eine Gelegenheit, Eurer Mutter einmal zu zeigen, wie lieb Ihr sie doch(!) habt. Denkt in aller Ruhe darüber nach, was Euch an Eurer Mutter so gut gefällt, was Ihr Schönes mit Ihr erlebt habt. Fragt am bestem auch mal Euren Vati.“ (4.5. 77),
von denen sie die „herzigsten“ veröffentlichte
„Du bist die liebste Mutti, denn Du machst mir den besten Kaba. Ich danke Dir, daß Du mich immer in Dein Bett nimmst, wenn mir mein Knie wehtut. – Andreas Fitzek (7), Frankfurt.“ (7.5. 77)
Nur ganz kleine Ehesorgen Doch Bild verschließt sich nicht den Schwierigkeiten des häuslichen Zusammenlebens, sondern gibt ihren Lesern Tips, wie sie aus dem täglichen Kleinkrieg als Sieger hervorgehen können, ohne die Familie zu gefährden: „So soll man Ehemänner behandeln! Zwinge ihn, sich zu rasieren. Hinterher gibt es ihm Auftrieb. Eine scharfe Bügelfalte freut ihn auch dann, wenn er behauptet, auf Kleidung keinen Wert zu legen. Sagst Du ihm Wahrheiten, so tu es nie vor Drittelt. Die Stärke des schwachen Geschlechts ist seine Schwäche. Weine dennoch nur selten, sonst gewöhnt er sich daran. Weine vor allem nur dann, wenn Deine Augen nicht anschwellen.“ (26.6. 52) Wenn so klargestellt ist, wie weit man gehen darf und an was man sich alles zu gewöhnen hat, so braucht man sich doch nicht alles gefallen zu lassen: „Frau nahm acht Igel ins Bett – Scheidung.“ „Beamter zog Mauer durch die Wohnung – Scheidung! |
 |
„Ehemann vergewaltigt eigene Frau – Bußgeld!
Es gibt zwar 16 Millionen Ehepaare in Deutschland trotzdem ist dieser Ehe-Fall wohl einmalig: ein 26-Jähriger Münchner Kaufmann ist zu 2000.– DM Bußgeld verurteilt worden, weil er seine eigene Frau vergewaltigt hat. Auf dem Wohnzimmerteppich.“ (21.4. 77)
Scheidungen sind also nur in Ausnahmefällen gestattet – und solange nur die Frau keift, wenn man zulange in der Wirtschaft hockt oder die Kinder nicht spuren, besteht kein Grund zur Aufregung. In solchen Fällen sollte man Bild zur Hand nehmen und sich an der Geschichte der frommen Pegolia und ihres Franz erheitern – denn gibt es etwas Komischeres als nach 31- jähriger Ehe 90 Eier für die armen Indios verzehren zu müssen:
„An 90 harten Eiern zerbrach die Ehe einet Busfahrers.
Die fromme Hausfrau Pegolia (56) hatte es gut gemeint; gleich 90 hart gekochte Ostereier kaufte sie in ihrer Kirche. Der Erlös (35 Pfennig das Stück) sollte armen Indios in Paraguay zugutekommen! Doch dann zerbrach erst ein Drittel der Wohltätigkeitseier und dann Pegolias Ehe. Und das kam so: »So. Jetzt müssen die Eier aber auch weg.« hatte die rundliche, herzensgute Frau ihrem Franz (57) gleich nach Ostern verkündet. Der Busfahrer mußte eine Woche lang Eier am laufenden Band essen: russische Eier, italienische Eier, Eier in Senfsoße, pochierte Eier. Sogar als er Magendrücken hatte, servierte Pegolia ihm Leichtverdauliches: Eiersalat.
Da feuerte der sonst gutmütige Busfahrer erst die Salatschüssel an die Wand und dann die 32 noch nicht verzehrten Eier durch die Wohnung. Das letzte der bunten Pracht verhalf Pegolia zu einem blauen Auge. Die Hausfrau flüchtete zu ihrer verheirateten Tochter und reichte die Scheidung ein.
Franz dagegen hofft, daß ihm seine Pegolia verzeiht. Er hat seine Sünde bereut.“ (20.4. 77)
Zum Luxus geboren
Der Ehestand wird insbesondere dann leichter verdaut, wenn man auch aus dem Liebesleben
der high society, deren angeborene Vorzüge bewundernd anerkannt werden:
„Mich haben schon berühmte Leute gefragt, wie es möglich ist, daß meine Tochter mit jeder Geste, mit jedem Schritt eine Königin ist.« – Sie meinen eine angeborene Königin, Frau Sommerlath ?
»Ja genau. Ich habe darüber nachgedacht. Silvia – es gibt keine andere Erklärung – ist mit diesen Eigenschaften geboren. Ich habe doch alle meine Kinder gleich erzogen ...«“ (19.4. 77),
nicht ohne sich über deren Verschwendungssucht, sobald sie nicht der Repräsentation des Volkes dient, erhaben zu fühlen und sie daher mit Verachtung zu strafen:
„Der Playboy und der Luxus. Maßstäbe? Es gab sie nicht. Das Teuerste und Vornehmste war für Ernst-Wilhelm Sachs gerade gut. »Der Verkäufer hat ganz schön geschaut, als wir unsere Scheckhefte zückten und jeder 29000.– DM ausschrieb. Soviel kosteten damals die beiden silbergrauen 300 SL mit Flügeltüren.«“ (13.4. 77)
 |
So lernt man, daß Liebe nicht geht – und es somit nicht am Mangel liegen kann, wenn man nicht glücklich wird. Diejenigen, die sich keinen Wunsch verkneifen müssen, werden gerade deshalb nicht glücklich: „»Es ist die ideale Ehe«, scherzt Shirley MacLaine, »Steve lebt an einem Ende der Welt und ich am anderen, und wir können beide schlafen, mit wem wir wollen.«“ (17.4. 77) und sind deshalb und auch wegen der vielen Sorgen, die ihr Reichtum mit sich bringt, auch nicht zu beneiden. Denn nicht nur sind sie Menschen: |
„Denn wir alle sind Menschen. Nie ganz glücklich und nie ganz unglücklich. So ist der Mensch.“ (zit. nach IV, 7),
was schon genügend Probleme mit sich bringt:
„Ist es die Liebe ? Prinzessin Caroline nahm 20 Pfund zu!
Sie hat neuerdings BH-Größe 80, Pausbacken, kräftige Oberarme und einen viel zu kräftigen Po – einfach unmöglich!“ (26.5. 77)
„Warum Prinz Philip die Queen rauswerfen wollte.
Das hat die Welt noch nicht erlebt: Auch zwischen Königin Elizabeth und Prinz Philip kommt's zum Ehekrach. Ein guter Freund der beiden hat einen erlebt. Er berichtet:
»Die Queen und Prinz Philip waren bei mir in der Grafschaft Hampshire zu Gast. Wir wollten zum Polospielen fahren, aber Elizabeth brauchte endlos lange zum Umziehen (bei der Auswahl von Kapotthüten verständlich). Philip wurde immer nervöser. Als sie endlich erschien, rannte er zu seinem Auto – die Königin hinterher. ... Die Königin saß vorne rechts, Philip setzte sich ans Steuer. Er fuhr, daß seiner Frau Hören und Sehen verging. Ängstlich hielt sich die Königin am Armaturenbrett fest. In jeder Kurve zog sie tief den Atem ein und seufzte vorwurfsvoll, Plötzlich trat Philip hart auf die Bremse, hielt an und schrie die Königin an: »Wenn du das verdammte Geräusch nochmal von dir gibst, dann fliegst du raus!«
Die Königin machte keinen Mucks mehr.“(Angst vorm Fliegen?) „Philip fuhr weiter, genauso rücksichtslos wie vorher.«
Als sie angekommen waren, sagte der Bekannte, vermutliche(!) Philip's Onkel Lord Mountbattan, zur Königin: Ich verstehe nicht, wie du dir das gefallen läßt – schließlich bist du doch die Königin! Antwort: »Weil ich genau wußte, daß er Ernst macht! Er hätte mich glatt zu Fuß laufen lassen.«“ (26. 5. 77),
sondern sie müssen ihr Glück auch allzu oft ohne die Sicherheit der Ehe genießen:
„Anja Silja: 3. Kind vom Geliebten
Sie erwartet ihr drittes Kind. Der Vater ist zum dritten Mal ihr Chef. Er heißt Christoph von Dohnanyi (47). Er ist mit einer anderen verheiratet. Liebe ist ... wenn man sich seiner sicher ist!“ (26.5. 77),
oder zu diesem Zweck ihren einstigen Gattinnen horrende Ablösesummen zahlen:
„Simone Bicheron fordert eine finanzielle Entschädigung. Eine Million Schweizer Franken hat sie bereits bekommen.
Margie sagt dazu etwas verbittert: »Ich schäme mich deshalb ein wenig für Simone. Sie versucht aus Curd immer mehr Geld herauszupressen.«“ (29.5. 77),
so daß man erleichtert darüber aufatmet, daß einem wenigstens kein Geld abgepreßt werden kann – und man von den Gefahren, die so ein ausschweifendes Leben mit sich bringt, verschont bleibt. Denn Laster macht – vor allem im Alter – häßlich:
„Eine schöne junge Frau, ein Mann: Rätseln Sie nicht lange – es ist wirklich William Holden – oder doch das, was das Leben aus ihm gemacht hat. Wenn das Gesicht eines Mannes der Acker ist, in dem das Leben seine Furchen zieht, dann hat es bei William Holden tief gepflügt.“ (15.4. 77)
Charmant, charmant!
Deshalb schuftet man lieber und spart, und wenn man es dabei wie Meta (68) zu einer Million bringen sollte, kann man sich einem Lehrling mit seinem „ganzen Reichtum schenken“, denn Liebe macht schön:
„Die Ehe Haralds (21) mit Meta (68) kann beginnen
»Jetzt will ich das Leben genießen und vor allen Dingen die Liebe. Dreimal am Tag macht mich mein Harald glücklich. Es ist so schön, wie es noch nie war.« Und die Menschen in Neustadt gönnen der lebenslustigen Frau Seifert ihr Glück.“ (23.4.77)
Die Bildleser, die Meta ihr Glück gönnen, können aber ihr Alter noch abwarten, werden sie doch durch den Anblick dessen, was die Ehefrau weniger formvollendet zu bieten hat, von der Bildzeitung reichlich entschädigt:
„Das lustige Po-Spiel
Charmant, charmant – doch welches Mädchen hat den hübschesten Po ?“ (4.5.77),
die ihnen die nackten Weiber präsentiert, um sie vor Schlimmerem zu bewahren: Denn wer will schon aufgrund von dreisten, unzüchtigen Handlungen als Sittenstrolch und Frauenschreck von Bild angeprangert werden.
Wenn also die Unterhaltung der Bildzeitung darin besteht, diese zum Mittel einer Agitation zu machen, die die Leser in ihrer Meinung bekräftigt, daß das Eheleben auch seine Vorzüge habe und man sich das Leben nur versaut, wenn man zuviel von ihm erwartet, dann können nur politisierte Menschen, die gewohnt sind, auf ihre Art zu agitieren, der Bildzeitung den Vorwurf machen, sie unterhalte lediglich.
Auch der Angriff, Bild manipuliere ihre Leser mit Hilfe von
„Sex-Photos und -berichten, weil sie in der Sex-Darstellung besondere Möglichkeiten entdeckte, die Wünsche ihrer Leser zur Triebkraft von Manipulation zu machen.“ (IV, 49),
kann eine Zeitung nicht treffen, die deutlicher als alle anderen ausspricht, was sie will.
Bettspiegel
Und was von Leuten zu halten ist, denen Bild als niveauloses Schmutzblatt mißfällt, zeigt sich nirgends besser als dort, wo sie sich selbst über derlei Themen verbreiten. Da Spiegelleser keine Familienpropaganda brauchen, bestätigen sie sich ihr Niveau dadurch, daß sie sich unter der Rubrik „Kultur“ über die neuesten Schweinereien der Bourgeoisie auf dem laufenden halten. Da der Spiegelleser „die Exklusivität der durch den Spiegel vermittelten Information schätzt“ (II, 9), will auch er an den Schwierigkeiten der „Emanzipationsversuche“(24/II) der Margaret Trudeau teilnehmen, während er an Alice Schwarzer seine Überlegenheit über Feministinnen mit der reaktionären Entdeckung feiert, ihre Probleme seien wirklich nur diejenigen einer frustrierten Frau, die keinen abbekommen hat. Der gebildete Mensch liest Oriana Fallacis „Briefe an ein nie geborenes Kind“ (21/77):
„Komm, schlafen wir miteinander, halten wir uns umarmt. Ich und du, ich und du, ... In unser Bett wird nie jemand anderes hereinkommen“ mit Wohlbehagen, d.h. als Staatsbürger: Dieses Buch „könnte sogar helfen, das hiesige Geburtendefizit auszugleichen.“ Vor allem aber demonstriert er seine Überlegenheit, weil er als moralisch freizügiger Mensch seine Nase in die stinkigsten Misthaufen steckt: „Die Sex- und Pornoindustrie vermarktet die Kinder. In diesem Geschäft offenbart sich ein gestörtes Verhältnis der Erwachsenen zum Nachwuchs.“(22/77). „Gegenkultur: Die Brüllkommune des Otto Mühl“ (20/77), weil nicht nur er sich mit diesem Interesse an Unmoral seinem Bildungsideal annähert, sondern insbesondere die Demokratie schöne Fortschritte macht, da sie jedem freistellt, sich auf die eine oder die andere Tour zu „mißbrauchen“: |
 |
„Opas Porno-Kino
Im Gegensatz zu manchen modernen Moralisten sieht Kenneth Tynan in der Entwicklung zum Porno keine Gefahr für die Privatsphäre: »Ein unveräußerliches Recht verbindet die Menschheit – das Recht auf Selbstmißbrauch. Das – und nicht der Mißbrauch anderer – zeichnet den wahren Liebhaber der Pornographie aus. Wir sollten ihn ermutigen, sein literarisches (!) Vergnügen zu suchen, wo und wie er es findet. Ihm dieses Privileg(!) abzusprechen, heißt die tiefste Privatsphäre verletzen.«“(19/77)
VI. Andachtsobjekte für gehobene Ansprüche und Lieber Franz, armer Ludwig!
Als Mensch mit Kultur verachtet der Spiegelleser daher den Bildleser, der täglich seine vier Seiten Sport liest und um den Erfolg der deutschen Elf bangt:
„Lieber Franz,
Wir haben zwölf herrliche Bundesliga-Jahre mit Dir erlebt, Du hast uns in vielen Deiner 103 Länderspiele begeistert. Wenn man so will: Du hast viel mehr als Deine Pflicht getan. Es kann Dir also auch niemand übel nehmen, wenn Du den Rest Deiner Fußballer-Jahre für eine Riesensumme nach Amerika gehst. Niemand! Nur eine Bitte. Tu's wirklich erst nach der Weltmeisterschaft 1978 – wie Du es immer versprochen hast.
Das bist Du Deinen Millionen Anhängern schuldig.“ (13.4.77),
was natürlich nicht heißt, daß der Spiegel Beckenbauers Wechsel zu Cosmos nicht ebenso bedauert wie versteht.
Im Kulturteil von Spiegel und Bild kommt die Kunstfeindschaft des Bürgers in je angemessener Weise zum Ausdruck: während der intellektuelle Spiegelleser darin seine Freiheit behauptet, sich für jeden Mist des modischen Kulturbetriebes zu interessieren, und so auch den Umweltverschmutzungen des Machers H.A. Schult noch den prickelnden Reiz des Unkonventionellen abgewinnt, das als Gegenstand für den Party-Small-Talk das eigene In-Sein unter Beweis stellt, mißt Bild Kunst auf die brutale Tour an ihrer Nützlichkeit für Staats- und Gesellschaftsmoral und spricht den Individualexkrementen, die heutzutage als Kunst auftreten, aus diesem Grunde den Kunstcharakter ab.
Streit ums Loch
Um Wahrheit und Schönheit ist es dem Spiegel nicht zu tun, wenn er noch jedem Land-Art-Bohrer Seriosität bescheinigt:
,,»An der ernst gemeinten Absicht« de Marias hegt selbst die »Frankfurter Allgemeine« keinen Zweifel: »Keine Clownerie, sondern ein ökologisches Andachtsobjekt.«“(19/77) –
die natürlich die nicht zu würdigen verstehen:
„Zumal das einfache Volk verdammt das Projekt in Grund und Boden, wo es ja auch hin soll (!).“ (ebd.),
die nicht wissen, welche Idee hinter dem Kunstwerk steht:
„Und vom Künstler selbst ist das Zitat überliefert: »Dreck und Erde ist nicht nur da, um gesehen zu werden, sondern auch, damit man darüber nachdenkt« – Grundidee einer »Land Art« genannten Kunstrichtung.“
Der Bildleser fühlt sich und seinen Staat verarscht, wenn die Freiheit der Kunst und seine Steuergelder dazu benutzt werden, die Nation, so unverständlich zu repräsentieren:
„Die Freiheit, ein Loch zu bohren
Wie verbohrt darf Kunst sein?
Sie ahnen, das Loch von Kassel...
Ein Schelm, dachten wir vor zwei Wochen,
ein Schelm nimmt uns da auf den Arm
mit einem Plan, der nie realisiert wird.
Weit gefehlt.
Das Loch von Kassel wird gebohrt, das Kunstwerk. Wir leben, gottlob, in einem Land mit künstlerischer Freiheit.
Drum nenne, wer will, das Loch von Kassel ein Kunstwerk.
Wir nehmen uns die Freiheit, das Kunstwerk von Kassel ein Loch zu nennen.
Da macht sich einer ganz schön lustig über uns.“ (7.5. 77)
![]()
Mit Melodien ...
Der Bildleser, der keine Anstrengung investieren kann, um seinen Sinn fürs höhere zu demonstrieren, unterhält sich daher nicht mit Kunst (oder was der Spiegelleser dafür hält):
„Solange es noch Melodien gibt, die noch hindurchdringen durch den Lärm der Motoren, durch das Pfeifen der Raketen, indem sie Menschen hier und allerorten die Sinne bewegen – solange ist der alte Kontinent Europa noch nicht verloren. Noch hängt er an dem leichten goldenen Band der Musik, die überall verstanden und erlebt wird.“ (22.11. 58),
was nicht heißt, daß er nicht weiß, daß man dazwischenfunken muß, wenn die DDR den Beethoven für sich in Anspruch nimmt:
„Armer Beethoven
Was dem Hitler sein Richard Wagner war, ist dem Honecker sein Ludwig van.
Armer Beethoven.
Da feiern sie drüben »die Einheit von Person und Werk«,
Dabei war die Person im Gegensatz zum genialen Werk kleinlich und geizig.
So herrlich seine Musik ist, so wenig herrlich ist Mensch Ludwig.
Die Haushälterin bekam einen Sessel auf den Bauch, das Dienstmädchen Bücher an den Kopf: Es steht noch unter dem Vieh.
Seine Mitbürger sind »bloße Instrumente, worauf ich, wenn's mir gefällt, spiele. Ich taxiere sie nur nach dem, was sie mir leisten.«
Das freilich könnte auch Honecker gesagt haben. „Schrecklich, diese deutschen Weltverbesserer. Wenn drüben ein Müller der Gewaltherrschaft entfliehen will, wird er umgelegt. Wenn hüben ein Buback die Gewaltherrschaft verhindern will, wird er umgelegt. Und wenn einer tot ist, wird er verlogen, umgebogen. Umfunktioniert zum 150. Todestag. Held der sozialistischen Musik. Eroica mit Hammer und Zirkel.“ (10.4. 77)

... gegen Handkes Schweigen
Wenn so dem Bildleser das tiefe Verständnis des Spiegellesers für die „Preziosität“ des Handkeschen Schweigens (19/77) abgeht und er auch mit Hitlers Bunkerruinen andere Vorstellungen verbindet:
„Jean–Pierre Reynaud, 38, wertet die bizarren Kunstquader als Kunstwerke. Er sieht ästhetische Verbindungen zu Aztekenbauten, etruskischen Gräbern und Pyramiden. In der äußersten Strenge der Hitler-Werke »liegt schließlich das Schöne«.“ (21/77),
so bedeutet das nicht, daß er die Moral, die ihm die Massenkultur ohne Schnörkel zur Unterhaltung anbietet, nicht zu schätzen wüßte oder auf der anderen Seite der Kultur eines Handke die Moral abginge
xxxxxxxxxxVII. Alle Wege führen zum Staat:xxxxxxxxxx Für 2 Mark 50 und ein paar Groschen
Deshalb stehen sich auch die beiden in ihrer Verachtung des Geistes in nichts nach: während Bildleser auf die Intellektuellen schimpfen, weil sie in ihnen, die sich dem Staat nicht wie sie umstandslos, sondern auf die kritische Tour verpflichten, eine Bedrohung für den Staat sehen, weshalb sie sich zu ihrem IQ von 100 gratulieren:
„Wie ein ehrgeiziger Vater seine Tochter zum Genie erzog
– Als Baby hörte sie nur klassische Musik
– Mit 5 las sie das Lexikon
– Mit 15 machte sie den Doktor in Mathematik
Edith Stern ist das geworden, was ihr Vater wollte: ein Genie. Bei jedem Intelligenztest kommt sie auf über 200 Punkte (normal: 100). ... Aber ans Heiraten denkt sie noch nicht – sie hat nämlich noch keinen Freund. Dabei ist sie schon 25.“ (25.4.77)
wissen auch Spiegelleser, daß allzuviel Geist ungesund ist – weil einen sonst ,,Partygespräche überfordern“:
„... glaubt der Autismus-Forscher, daß die Grenzen zwischen Kalender-Idiotie und Genialität fließend sind. Manches wissenschaftliche Genie habe, jedenfalls in gewissen Lebensperioden, autistische Wesenszüge hervorgekehrt und dabei phänomenale Denkleistungen vollbracht.
So habe etwa der Physiker Isaac Newton, selbstversunken und unansprechbar wie ein Autismus-Patient, die Schwerkraftgesetze formuliert. Und bei Albert Einstein, dem Schöpfer der Relativitätstheorie, seien Autismus–Symptome noch deutlicher zu erkennen gewesen.
Das Jahrhundert-Genie, als Kind scheu und kontaktarm, lernte wie Rimlands Autismus-Patienten erst spät, im vierten Lebensjahr, sprechen und fand sich – weitläufiger Verwandter jener debilen Kalender-Künstler? – zeitlebens im Alltag nur mühsam zurecht.“ (19/77)
Und so führen zuguterletzt alle Wege zu Gott: Bildleser lesen ihr Horoskop und wissen, daß sie ihrem Schicksal nicht entrinnen können:
„Die Lehre von Lengede heißt: Gott lebt doch! Gott hat viele Namen. Viele sind zu zaghaft, Gott zu nennen. Sie sagen »Schicksal« oder »Fügung« oder »eine höhere Macht«. Aber im Innersten wissen sie, wer in Lengede mitgeholfen hat.“ (zit. nach III, 30),
und Spiegelleser lassen sich von Psychologen bestätigen, daß „in der Astrologie ein Kern Vernunft steckt“:
„... Eysenck behauptet, daß »die Menschen bei ihrer Geburt verschiedene Persönlichkeiten, unterschiedliche Intelligenz, unterschiedliche Fähigkeiten« haben. Sie sind durch ihre Gene »sozusagen programmiert, auf bestimmte Weise zu reagieren«, über die Art des Programms geben die Planeten Auskunft.“ (22/77)
Da der Bildleser ohnehin weiß, daß es auf ihn nicht ankommt und er gerade darin seinen Platz in der Welt behauptet, muß man ihn nicht auf den „rationalen Kern“ der Astrologie hinweisen: für ihn bringt seine Zeitung das tägliche Horoskop:
„Wenn Sie zuviel verlangen, kriegen sie am Ende gar nichts. Einsatz im Beruf wird sich auszahlen. Am Nachmittag eine unverhoffte Begegnung.“
Aber auch Spiegelleserin Hilde Knef läßt sich ihre Sterne zum Hochzeitstag von einem teuren Experten berechnen, weil es auf keinen Fall schaden kann, auch noch die Planetenkonstellation dafür verantwortlich zu machen, daß man sich mit den Sorgen derjenigen nicht herumschlagen muß, die auf eine günstige Konjunktion hoffen, weil sie sich sonst nichts zu erhoffen haben.
Was dieser Eysenck den Lesern des Deutschen Nachrichtenmagazins streng wissenschaftlich untermauert, ist deren Gewißheit, daß es Blöde nicht nur gibt, sondern geben muß, nicht zuletzt deswegen, daß sie sich jeden Montag nicht nur den relativ bescheidenen Luxus leisten können, DM 2.50 für bedrucktes Papier auszugeben, sondern sich des Vorteils gegenüber dem Bildleser erfreuen dürfen, ihr Einverständnis in ironischer Distanz zu Staat und Gesellschaft wiederzufinden, während sich die Bildleser das Lob ihrer Opferdaseins auch noch täglich ein paar Groschen kosten lassen müssen.
I: Hans Magnus Enzensberger: „Einzelheiten I, Bewußtseins–Industrie. Die Sprache des Spiegel“ (1957) II: „Der Spiegel: Image und Funktion. Eine Untersuchung bei Spiegel-Lesern über Leseverhalten und Beurteilung des Spiegel.“ Hrsg. Spiegel-Verlag (1971) III: „Bild ist Wahrheit. Der Meinungsfreiheit eine Gasse“, geschlagen von Alfred Lugenberg (1968 by Wissenschaftliche Verlagsanstalt zur Pflege deutschen Sinngutes im Heinz Moos Verlag München) IV: „Der Untergang der Bild–Zeitung“ |
aus: MSZ 18 – Juli 1977