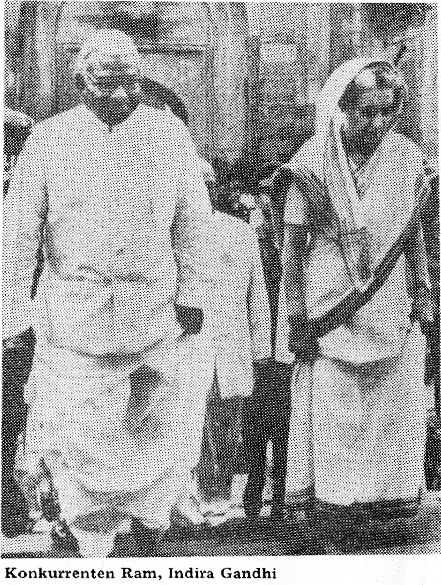Regierungswechsel ziemlich außerparlamentarischer Natur
Kontinuität in Südkorea
Daß Politik – trotz der vielen damit zu erringenden Ehren – für ihre Träger eine recht gefährliche Sache sein kann, wenn man sich nicht auf den gesicherten Pfaden der Demokratie bewegt, mußte zuletzt der südkoreanische Präsident Park Chung Hee erfahren. Trotz umfassender Sicherheitsmaßnahmen, die bei der Inhaftierung der wenigen Streiklustigen seines Landes anfingen und bei der Beantwortung von Studentendemonstrationen mit Kriegsrecht aufhörten – koreanische Spezialität: ins Ausland geflüchtete Oppositionelle entführen, um sie daheim ganz sicher aufzubewahren –, geriet er ausgerechnet dem eigenen Geheimdienstchef in die Schußlinie. Und das bei einem kleinen privaten tete-d-trois in den geheimdienstlichen Clubräumen. Unter Anwesenheit südkoreanischer Unterhaltungsdamen, woran man sieht, wie selbst das Privatleben unter dem Amt Schaden nehmen kann.
Dank der unübersehbaren Präsenz der Amerikaner im Lande, sicherheitshalber wurden noch ein paar Zeichen der Bündnistreue zu Wasser aufgefahren, verlor das nach dem plötzlichen Ende Parks hierzulande befürchtete Machtvakuum sehr schnell seinen Schrecken, so daß man sich um die Fortführung des Park’schen Lebenswerks wohl nicht zu sehr sorgen braucht. Südkorea, ein „erfolgsorientiertes und leistungsfähiges Gemeinwesen an der Schwelle zum modernen Industriestaat“ dürfte wohl auch weiterhin seine Leistungsfähigkeit durch die amerikanischen Sicherheitsinteressen in der Region garantiert bekommen und mit seiner Billigstarbeiterarmee bei westlichen und japanischen Lohnveredelern gut im Rennen liegen, Erfolgsorientierungen wie galoppierende Inflation und Arbeitslosigkeit inbegriffen. Der Neue, Choi, am Grabe Parks: |
 |
„Park sei es gelungen, dem Volk Selbstvertrauen und Stolz zurückzugeben und seine verborgenen Fähigkeiten (er meint wohl die zum Zusammenbasteln von Taschenrechnern und Oberhemden im Akkord) wiederzuerwecken.“
|
Weshalb sich auch der Fernostkorrespondent der MSZ nicht recht der Auffassung anschließen mag, Park habe es in seinem Sicherheitsbedürfnis zu weit getrieben, sein Stuhl habe bereits gewackelt wegen allzu flagranter Verletzung von Menschen und sonstigen Rechtlichkeiten. Das kann ja wohl nicht sein in einem Staat, in dem es sich die Politiker sogar leisten, aufeinandereinzuballern, statt den Streit um die Macht durch das Volk entscheiden zu lassen. Sein im Sinne weltpolitischer Stabilität schnell ausgemachter Nachfolger, der bisherige Ministerpräsident Choi setzt weiterhin auf die bewährten Park’schen Methoden und hat bereits ein paar allzu hoffnungsvolle Oppositionspolitiker hinter Schloß und Riegel gebracht. Daß er zum Amtsantritt auch wieder ein paar amnestieren will, denen man im Knast einige Zähne gezogen hat, sorgt für den Ausgleich. Es scheint also weniger die unausweichliche Demokratisierung gewesen zu sein, die sich den Geheimdienstchef zum Werkzeug nahm, als dessen Absicht, sich bzw. seine Kumpane an Parks Stelle zu setzen. |
In die Tat umgesetzt wurde diese zwar im Vergleich zu hiesigen Verfahrensweisen etwas ungewöhnlich, aber ein Staat, der seine Existenzberechtigung nach innen und außen per Kriegsrecht vertritt, pflegt dem Willen zur Macht auch keine geordneten Karrieremöglichkeiten in der Parteienkonkurrenz anzubieten. Tatenhungrige Politiker müssen sich dort eher unorthodoxer Methoden bedienen, was hierzulande ohne weiteres anerkannt wird, aber auch nur dann, wenn es die erwünschte Staatssicherheit ergibt. Aber auch nur dann.
Ein den Methoden nach zwar recht ähnlicher, der Sache, d.h. der weltpolitischen Akzentsetzung nach aber ganz anders gelagerter Regierungswechsel – in Afghanistan kostete eine Auseinandersetzung zwischen dem „treuen Schüler Amin“ und seinem „großen Lehrer Taraki“ Taraki das Leben – fordert deshalb Spekulationen heraus, ob die „Schreckensherrschaft des wilden Amin“ nicht überfällig sei. Die Bündelei der Afghanen-Chefs mit Moskau – wo Marxismus im Land praktiziert wird, war bislang nicht zu entdecken – und ihre internen Schwierigkeiten mit aufständischen Moslems berechtigen zu den kühnsten Hoffnungen: „Ein Vietnam für die Sowjets?“
Wahlkampf in der Welt größter Demokratie
Etwas gefälliger sind da doch die Praktiken in der berühmten größten Demokratie der Welt: der indische Wahlkampf läuft auf vollen Touren und es ist nach hiesigen Kriterien immerhin einer, wenn auch mit leicht anrüchigen Methoden, die man aber dem im Kern doch recht wenig zivilisierten Riesenvolk zugutehalten muß. Da beschimpfen sich sämtliche relevanten Politiker, unterstützt von einschlägigen amerikanischen Veröffentlichungen u.a. des ehemaligen UNO-Delegierten Moynihan, wechselseitig damit, ihre Gelder von den beiden dafür in Frage kommenden Ausländern zu beziehen. KGB- oder CIA-Agent ist die Frage, die wir wiederum weniger für eine des schlechten Stils als für eine sachlich entscheidende halten. Daß die indischen Massen angesichts dieser „Schmutzkampagne, in der kaum noch auf nationale Sicherheitsbelange Rücksicht genommen wird“ in abgrundtiefe Staatsverdrossenheit verfallen, ist doch eher unwahrscheinlich in einem Land, in dem es zur jahrzehntelang gepflegten Wahlkampfübung gehört, dem Gegner vorzuwerfen, daß seine Politik den Staat vom falschen Ausland abhängig machen würde. Die Wahlfreude wird ihnen, soweit sie nicht gerade mit Verhungern, Überschwemmungskatastrophen oder der Cholera beschäftigt sind, mit den probaten indischen Methoden schon beigebracht und dafür sind die Gelder doch ziemlich ausschlaggebend, sei es für einen kleinen Wahlobolus oder für die Unterhaltung der Schlägerbanden.
Daß Indira momentan nicht schlecht gehandelt wird, zeigt sich schon daran, daß prominente Politiker ihre jeweilige Partei verlassen, Amt und Würden entsagen und in Erwartung der nächsten ins Indira-Lager überwechseln. Den Vorwand, es ginge um die Verwirklichung gewisser, weltanschaulich tief fundierter und volksmäßig ausgewogener Programme, brauchen indische Regierungswechsel weiß Gott nicht. Als konkurrierende Zusammenschlüsse zur Aufteilung der Macht können die indischen Parteicliquen die Konkurrenz bequem durch gewisse Umgruppierungen untereinander vorentscheiden, was unter anderem den Vorteil ziemlich langlebiger politischer Tätigkeit mit sich bringt, so daß man bei geschicktem Kalkulieren immer mal wieder dran kommt. Hinzu kommt, daß die indischen Politiker von der Last der Verantwortung befreit worden sind, als einziges funktionierendes Staatswesen in Asien ein demokratisches Bollwerk gegen die Chinesen zu bilden. |
|
Unübersichtliche Lage in Bolivien
Wo sich die interessierten und befugten Bevölkerungskreise intern nicht zu einigen vermögen, weil bei entsprechender Benützung der Staatsgewalt für die unterschiedlichen Fraktionen unterschiedlich viel herausspringt, und wo unglücklicherweise auch sämtliche Fraktionen ihre Vertreter im Militär besitzen, gestaltet, sich der Regierungswechsel zuweilen recht unübersichtlich, wie zur Zeit in Bolivien. Ein mühsam ausgefeilschter ziviler Übergangspräsident wurde weggeputscht, der Putschist selbst besaß nicht genügend Durchhaltevermögen, übergab unter gewissen Bedingungen die Regierungsgewalt wiederum in die Hände einer zivilen Präsidentin, die, kaum an der Macht, sich wieder einem Putsch gegenübersah, mit dem sich ein zurückgesetzter General eine Neubesetzung der militärischen Führungsposten und damit die Startlöcher zum erneuten Eingreifen erkämpfte.
Daraus, daß alle Mitwirkenden – ungehindert von ihren sonstigen Differenzen – sich als erstes auf die Menschenrechte verpflichten, sich voll auf die Seite des Volkes stellen und versprechen, „mit Hilfe der Bauern, Arbeiter und Studenten der Anarchie im Lande ein Ende zu beten“ (wer macht sie denn bloß immer, die Anarchie?), sollte man sich nicht das hierzulande beliebte Problem der Einschätzung machen, ob man es nun mit linken oder rechten Figuren zu tun hat. Einträchtig „mit dem Volk“ das Regierungsgeschäft erledigen, so funktionell wie die westlichen Staaten, ist nun einmal das Ideal solcher Nationen, wo die Massen ebensogut zu Teilen zur Mitarbeit am nationalen Reichtum herangezogen werden wie sie wegen ihrer unbrauchbaren Ansprüche, auch ernährt zu werden, politisch eine gewaltsame Disziplinierung benötigen. Das hindert deren Staatsmänner selbstverständlich nicht daran, mit dem Opfern und Zusammenschießen von ein bißchen Volk sich ihren Platz zu erkämpfen. Und daß sie sich bei dessen Erhaltung auch wohlweislich nicht vom Nachfragen beim Volk, obs recht ist, abhängig machen, ist bei dessen notorischem Mangel an Begeisterung für die angebotenen Perspektiven von Ausbeutung und Verhungern auch nur zu verständlich. Den Mißerfolg von Oberst Natusch Busch und seine über ein paar Postenneuverteilungen vollzogene Versöhnung mit der Zivilregierung haben denn auch nicht zuletzt die amerikanischen Freunde verursacht, die die Wirtschafts- und Militärhilfe sperrten und den Oberst damit gegen die anderen Militärteile ins Hintertreffen brachten. Dem State Department scheint momentan in Bolivien wohl die Alternative einer – durch das Hinzuziehen von ein bißchen wohldosiertem Volkswillen möglicherweise etwas dauerhafteren – Zivilregierung eher angebracht zu sein. Mit der Wiederaufnahme der Militärhilfe haben die Amerikaner die Argumente für jede Sachlage in der Hand.
Klare Verhältnisse in Chile
In Chile hingegen liegt die Stabilitätsgarantie zur Zeit eindeutig bei der Junta, die sich sogar kleine Unhöflichkeiten gegenüber ihren westlichen Bündnispartnern leistet, die ihr von Zeit zu Zeit das Versprechen abnehmen, sich nicht allzu abschätzig über den Nutzen der Demokratie zu äußern. Ihr Chef, Pinochet, hat wieder einmal erklärt,
„sein Land brauche weder Parteien noch Politiker, um vorwärtszukommen. Wichtigste Aufgabe der Regierung sei es, die Rückkehr ins Chaos zu verhindern.“

Wofür er mit der wieder einmal steigenden Zahl von Folterungen einsteht und wofür ihn seine Freunde in den großen Demokratien einstehen lassen, denen ja auch jegliches Chaos zutiefst verhaßt ist. Solange Präsident Pinochet dieses, sein Programm erfolgreich durchexerziert, besteht also für westliche Demokraten wirklich kein Grund zum Regierungswechsel oder zur Veranlassung solcher Schritte.
Liberaler Putsch in San Salvador
Wenn aber trotz und dank der chaosverhütenden Methoden die Herrschaft allzu kostspielig wird und auch der Erfolg gefährdet ist, werden sich sicher auch in den Reihen Pinochets wieder Politiker für einen Regierungswechsel finden, der dann, wenn er so gelingt wie in San Salvador, nämlich als Vorbeugemaßnahme zur Verhinderung eines größeren Volksaufstandes gegen einen überalterten Diktator, den schönen Titel liberaler Putsch erhält. Ganz liberal, nämlich durch ein paar Metzeleien und das Zugeständnis, man werde Reformen zugunsten der Bevölkerung ins Auge fassen, haben sich mittlerweile auch die Aufständischen des Revolutionären Volksblocks unter Kontrolle bringen lassen und den Amerikanern erspart, an der Standfestigkeit der Junta zu zweifeln. Deren Chef gab sich zufrieden:
„Der Triumph unseres Volkes hat viel Blutvergießen und über 100 Tote gefordert, doch zum erstenmal hat eine salvadorianische Regierung die Rechte des Volkes anerkannt.“
Das kann man allerdings auch billiger haben. Die OAS, Organisation amerikanischer Staaten, hat neuerdings
„in einer einmütig verabschiedeten Erklärung die Folter verurteilt und die Militärregimes aufgefordert, demokratischen Regierungssystemen Platz zu machen.“
Damit die folternden Militärs die an sich selbst erteilte Aufforderung auch nicht vergessen, die häßlichen Methoden ihrer Machtausübung nur, wenn unbedingt notwendig, zu praktizieren, haben sie, pardon, die OAS gleich auch noch die Errichtung eines interamerikanischen Gerichtshofes beschlossen, der sich mit Verletzungen der Menschenrechte in den Mitgliederstaaten befassen soll. Das erspart dem Volk immerhin den Gang zur UNO, und der Weltöffentlichkeit die Anstrengung, die Militärs zur Einhaltung der Menschenrechtspolitik zu zwingen, zumal da sich von den 27 Staaten immerhin schon 7 dazu bereit erklärt haben, sich an die Entscheidungen des Gerichtshofs zu halten.
Verkürzungen bei Marx
Die MSZ-Redaktion kann angesichts der weltweiten Verfassungsbemühungen der Marx’schen Imperialismusanalyse,
„Es wird behauptet, gewisse ausländische Bankiers, bei denen eine gewisse Regierung neue Anleihen aufnehmen wollte, hätten als Garantie eine Verfassung verlangt. Aber weil ihre moderne Methode, Geschäfte zu machen, sich bis jetzt wenigstens mit allen Regierungsformen vertrug und das auch konnte, liegt es mir fern, daran zu glauben.“ (Karl Marx, Briefe übers Kapital, S. 251)
den Vorwurf nicht ersparen, sich allzusehr auf der Oberfläche der Erscheinungen herumzutreiben. Marx verkürzt die unterschiedlichen Herrschaftsformen auf dem Globus auf das Wirken der mächtigen Finanzbourgeoisie. Er unterschlägt damit die politischen Subjekte, die westlichen Demokratien, die durch ihren Einsatz an der weltweiten Verfassungsfront, durch ihre mehr oder weniger direkten Garantien politischer Stabilität in allen Ländern, wo sie etwas zu garantieren haben, dafür sorgen, daß die Bankiers keine Verfassungsgarantie für Anleihen verlangen müssen und sich ihre modernen Geschäftsmethoden mit allen Regierungsformen vertragen. Daß der Seltenheitswert demokratischer Regierungsformen nichts mit demokratischer Gleichgültigkeit zu tun hat, sondern sich der brennenden Sorge demokratischer Politiker um ordentliche Regierungen überall verdankt, sollte damit wohl auch klargeworden sein. Demokratie ist nämlich nur in bestimmten Breiten eine Garantie für Anleihen.
Nachtrag in eigener Sache
Mit betroffener Verbitterung nahm das MSZ- Kollektiv eine kurze Meldung zur Kenntnis, die im November über Associated Press bei uns eintickte:
„Auf Haiti ist ein neues Pressegesetz in Kraft getreten, durch das es Journalisten verboten wird, den Präsidenten Jean-Claude Duvalier oder seine Mutter zu kritisieren. ... Durch das neue Gesetz kann ein Journalist mit bis zu drei Jahren Haft und einer Geldstrafe bis zu 1800 Mark oder beidem bestraft werden, wenn er den Präsidenten auf Lebenszeit oder seine Mutter »beleidigt«“.
Trotz dieser einschneidenden Erschwerung für die Arbeit unseres Südamerikakorrespondenten versprechen wir den Lesern, daß wir auch weiterhin das Kind beim Namen zu nennen gedenken.
aus: MSZ 32 – Dezember 1979